|
Japanische Motorrad-Importeure in Deutschland
"Die gelbe
Gefahr"
Das "Wirtschaftswunder"
brachte Deutschland Wohlstand und
das Automobil.
Vom Zweirad
wollte in den 1960er Jahren keiner
mehr etwas wissen. Ein ganzer
Industriezweig ging Pleite.
Fast.
Das Motorradgeschäft war
nämlich nicht tot,
sondern lag
nur im Koma. Soichiro Honda
hatte bereits im Mai 1961 in Hamburg
die "European Honda Motor Trading GmbH" eröffnet.
1964 verkaufte Yamaha ihr
erste Bike
bei uns und Phil Read
wurde erster Yamaha-Weltmeister. Als man
das bei uns merkte, redeten plötzlich alle von der "gelben
Gefahr".
Text: Winni Scheibe
Fotos: Scheibe, Louis, Röth,
Archiv, Werk |
|

Honda Super Cub C100 von 1958
Die erste
Honda Super Cub kam 1958 auf den Markt. Das leichte Viertakt-Kraftrad
mit
Beinschild entwickelte sich zum
erfolgreichsten Fahrzeug der Geschichte.
Bis Ende 2010 liefen weit über 60 Millionen
Exemplare vom Band!
(Foto: Honda)
|
|
Anfang der Sechziger
drehte sich die Welt plötzlich anders. Nichts schien mehr so, wie es
einmal war. Jugendliche ließen sich die Haare lang wachsen, trugen
abgewetzte US-Parkas, liefen in Bluejeans herum, hörten moderne Rock-,
Pop- und Beat-Musik. Der Nachwuchs muckte auf, gab Widerworte, ließ
sich nichts mehr gefallen. Schuld an allem waren die Beatles. Mit ihrer
Musik verdrehten sie den Kids die Köpfe, riefen zur gewaltfreien
Revolution auf: "All you need is love".
|
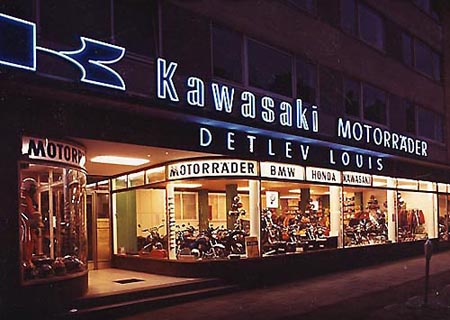
In den 60er Jahren war Detlev
Louis in Hamburg der größte Motorradhändler in
Deutschland
und ab 1968 auch noch Kawasaki-Importeur
(Foto: Louis) |
Nichts half dagegen,
weder Schimpfe noch Strafe, noch Zureden oder gute Worte. Ein noch nie
dagewesener Generationskonflikt war im Gange. Die Eltern verstanden
plötzlich die Welt nicht mehr, aus ihrer Sicht war "Hopfen und
Malz" sowieso verloren.
Dabei meinten sie es doch
nur gut. Schließlich sollten ihre Kinder es doch einmal besser haben.
Die kargen Nachkriegsjahre waren überstanden, es ging steil bergauf.
Alle Welt sprach vom "Deutschen Wirtschaftswunder", endlich
konnte die Bevölkerung sich wieder etwas leisten. Das Fernsehen
eroberte das Wohnzimmer, die Urlaubsreise ging nach Italien. Die Zeiten,
bei Wind und Wetter mit dem Motorrad zur Arbeit fahren zu müssen, waren
Gott sei Dank vorbei. Von den alten Knatterbüchsen wollte keiner mehr
etwas wissen. Der erste Kleinwagen stand vor der Tür. Ihm folgte ein VW
Käfer, später ein Opel Rekord.
|

Ende der 50er Jahre war
Motorradfahren out... |

... zum Zeichen des Wohlstandes
wurde das Auto: Opel Rekord von 1957 |
|
Dabei war
West-Deutschland in den Fünfzigern weltgrößter Motorradhersteller. In
dieser Blütezeit waren über 2,2 Millionen Maschinen zugelassen, dieser
Bestand rutschte bis Mitte der Sechziger allerdings auf 415.000
Motorräder ab - absolut gesehen. Doch der Schein trügte, 1964 ließen
sich nur noch knapp 8000 und 1967 sogar nur noch 4000 (!) Neumotorräder
verkaufen. Und von den ehemalig 40 großen Motorradmarken gab es nur
noch BMW, Maico, Hercules und Zündapp. Viele der einst ruhmreichen
Namen waren in Konkurs geschlittert, andere hatten sich rechtzeitig
anderweitig orientiert. Wie es um die Branche stand, brachte der eben
noch agierende Motorradmarktführer NSU in Neckarsulm 1966 unverhohlen
zum Ausdruck:
"...NSU wird nie wieder Motorräder bauen, die Zukunft
gehört dem Auto..." .
Wer etwas auf sich hielt, trug Hut, fuhr
Automobil, hatte ein Dach über dem Kopf, die Klamotten blieben sauber.
Die anderen auf ihren stinkenden Mühlen wurden
mitleidig belächelt oder als
"arme Schweine" bezeichnet.
|
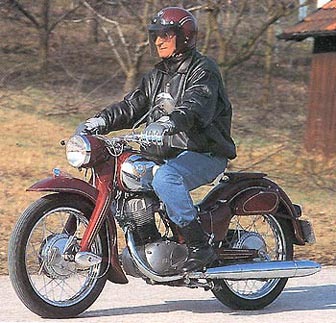
NSU Max |
|
Inzwischen waren die
Beatles weltberühmt. John Lennon behauptete sogar, sie seien "bekannter
als Jesus". Die Jugend hatte sich immer noch nicht beruhigt, und
wenn man schon damals bei uns gewusst hätte, was zur gleichen Zeit in
den USA los war, dann gute Nacht. Dort nämlich hatte eine neue
Generation das Motorrad als Spielzeug entdeckt. Für Spaß, Sport,
Abenteuer und Freizeit. Aber auch ein bisschen zum Ausbruch aus der
verspießten bürgerlichen Gesellschaft: "born to be wild". Es
gab allerdings auch etwas Positives am Spektakel, quer durchs Land war
ein gewinnträchtiger Motorradmarkt am Aufkeimen. Verantwortlich waren
diesmal jedoch nicht die vier "Pilzköpfe" aus Liverpool, sondern
die japanische Motorradindustrie, allen vorweg Honda, Yamaha, Suzuki und
Kawasaki.
|
Die
erste Honda fuhr 1959 über Deutsche Straßen
|
|
In Deutschland lag das
Zweiradgeschäft derweil am Boden. Nur noch wenige Werkstätten konnten
sich mit ihrer Arbeit über Wasser halten, Zukunftsperspektive:
trostlos. Ungeachtet dessen hatte Soichiro Honda bereits im Mai 1961 in
Hamburg die "European Honda Motor Trading GmbH" eröffnet.
Hierbei handelte es sich um eine 100prozentige Werksniederlassung des
japanischen Stammhauses. Die Order an die Mitarbeiter war unmissverständlich:
"Erobert den europäischen Markt". Kein
einfaches Unterfangen, schließlich stand Motorradfahren in der
Beliebtheitsskala ganz unten.
|

Honda-Werksteam 1959 bei der
TT... |
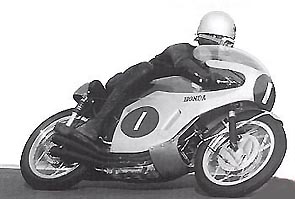
...und später der erfolgreiche
Werksfahrer und sechsfache Weltmeister Jim Redmann
(2
Fotos: Archiv-Honda)
|
|
Vollkommen unbekannt
waren Honda Motorräder bei uns allerdings nicht. Sportfans und
TT-Besucher wussten längst, dass beim populären Rennen auf der Isle of
Man 1959 das japanische Werk in der 125er Klasse die Team-Wertung
gewonnen hatte. Bereits zwei Jahre später hatten 1961 Tom Phillis die
125er und Mike Hailwood die 250er Straßenweltmeisterschaft gewonnen und
Werksfahrer Jim Redman ging mit seinen sechs WM-Titeln in die
Geschichte ein. Für die erste Honda auf deutschen Straßen sorgte Franz Steib, auch als
Seitenwagen-Steib bekannt. Ende 1959 ließ er eine 250er Zweizylinder C71 nach Nürnberg kommen. Das Bild, wie der japanische Flitzer via
Seilzug in seine Werkstatt gehievt wurde, ging in die Motorradgeschichte
ein.
|
|
Offiziell zu kaufen gab es Hondas ab Frühjahr 1960. Um den Import
kümmerte sich der Hamburger Motorradhändler Karl Heinz Meller. Vom
großen Geschäft konnte dabei aber kaum die Rede sein. Bis das
japanische Werk gut ein Jahr später die Sache selbst in die Hand nahm,
ließen sich nur wenige Maschinen an den Mann bringen. Aber auch bei
Honda selbst klappte es vorerst kaum besser. Schließlich begann man bei
der Stunde Null. Es wurden engagierte Mitarbeiter benötigt, es musste
ein Verwaltungsapparat organisiert werden und natürlich brauchte man
landauf,
landab Vertragshändler.
|

1959: erste 250er Honda in
Deutschland |

1963: Honda-Händler Fritz Röth mit
Honda CL77
(Foto: Röth) |
Zu den ersten gehörten Spaett in
München, Bruno Lippke in Kempten, Umbeer in Karlsruhe, Kannenberg in
Berlin und Fritz Röth in Hammelbach. Dennoch, immer wieder war immense
Überzeugungsarbeit erforderlich. Kaum ein Werkstattmann und noch viel
weniger die Motorradfahrer auf der Straße trauten den hochtourigen
Zweizylinder-Viertaktmaschinen etwas zu. Es konnte ja soviel kaputt
gehen, wie und wer sollte dann das Motorrad reparieren und von woher
sollte man die Ersatzteile bekommen. Skepsis und Misstrauen waren groß.
|
| Die kleine 125er CB92 Super Sport leistete beachtliche 15 PS bei
10500/min und die 250er CB72 Super Sport brachte es immerhin auf 24 PS
bei 9000/min. Kein Wunder also, dass bei uns die Experten von
hochgezüchteter Renntechnik sprachen. Unterstützt wurde diese Meinung
von Cheftester Ernst "Klacks" Leverkus der Fachzeitung "DAS
MOTORRAD". Über die 125er schrieb er: "...Lässt sich solch eine
Leistung überhaupt aus so einem kleinen Uhrmacher-Motor mit seiner
Kompliziertheit bei Massenherstellung herausholen... ?" Und über
die CB72 hieß es: "...Es waren nicht allein die 24 bis 25 PS, es war
dazu noch das wirklich sportliche Aussehen, die Details einer echten
Straßensport-Maschine, die nicht nur wegen einer Menge Chrompofel oder
wegen eines montierten Renn-Lenkers so getauft worden war...". Im
Vergleich dazu waren die 250er BMW und NSU Max "brav" und
"bieder"
und mit ihren gerade mal 18 PS einfach lahme Gäule... |

1959: Honda CB92, 125 ccm und 15 PS
(Foto: Honda)

1964:Honda CB72, 250 ccm und 24 PS
|
|
Drei
Jahre nach Honda kamen 1964 die ersten Yamahas zu uns
|
|
Dreh- und Angelpunkt des
Motorradgeschäftes war alle zwei Jahre die IFMA in Köln. Für den
zweitgrößten japanischen Motorradhersteller Yamaha sollte 1964 der
Einstand in Deutschland erfolgen. Gezeigt wurden drei Zweitakt-Modelle:
Die 250er DS-3 mit Zweizylinder-Motor, die 80er YG-1 und das Moped YF-1
mit Einzylinder-Triebwerk. Zuständig für die Präsentation war das
japanische Handelshaus Mitsui GmbH mit Sitz in Düsseldorf.
|

Yamaha 125 AS-1
|
|
Für alle, die sich
damals für Motorräder interessierten, gehörte die IFMA zum
Pflichtprogramm. So auch für den Allgäuer Honda-Händler Bruno Lippke.
Der Kemptener war von den Yamahas dermaßen begeistert, dass er sich
gleich auf der IFMA um einen Händlervertrag bewarb. Als erster
Yamaha-Händler Deutschlands schrieb Bruno Lippke somit Geschichte. Aber
das war längst nicht alles. Zwischen der Mitsui GmbH und dem Allgäuer
entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit. Bevor man nämlich die
Yamahas überhaupt verkaufen konnte, mussten sie erst die TÜV-Hürde
meistern. Auf Grund der geringen Stückzahl war an eine ABE (Allgemeine
Betriebserlaubnis) jedoch noch lange nicht zu denken. Und so musste jede
Maschine mit hohem Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erstellung des
erforderlichen Mustergutachtens beim TÜV vorgeführt werden. Hierfür
war Motorradspezi Lippke genau der richtige Mann, schon bald kümmerte
er sich um sämtliche technische Belange.
Den Aufbau des
Händlernetzes übernahm derweil die deutsche Mitsui GmbH, eine
Tochtergesellschaft der Mitsui & Co. Ltd. in Tokio, die mit weltweit
mehr als 200 Niederlassungen zu einem der größten japanischen
Handelsunternehmen zählte. Zu den Yamaha-Vertragshändlern der ersten
Stunde gehörten Karl Emonts in Köln, Klaus Verworner in Berlin sowie
Aermacchi-Importeur Witzemann in Karlsruhe. Bereits 1966 gab es
bundesweit 23 Vertragshändler, die rund 200 Maschinen an
Yamaha-Zweitaktfans verkauften.
Motorräder verkaufen,
warten und reparieren war in jener Zeit aber meist mehr als nur "ein
Geschäft" machen. Einige Händler waren aktive Rennsportler,
andere sah man regelmäßig bei bekannten Motorradtreffen und andere
engagierten sich in Clubs oder Vereinen. Bei vielen floss "Benzin in
den Adern", sie hatten ihr Hobby zum Beruf gemacht. Und da die
ganze Branche noch im Aufbau steckte, zählte jede Person, die sich für
die Sache einsetzte. Um so tragischer war für die Mitsui der
plötzliche Tod von Bruno Lippke.
Ersatz, aber nicht nur
das, sondern auch noch einen außerordentlich engagierten Nachfolger,
fand man in Manfred Weihe. Der Motorradhändler aus Löhne/ Westfalen
war einer der ersten Yamaha–Besitzer in Deutschland, seit 1964 fuhr er
eine DS-3. Ab 1966 kümmerte sich sein Betrieb um die gesamte technische
Abwicklung einschließlich der TÜV-Zulassungen sowie der
Ersatzteilversorgung.
|
|
Rennveranstaltungen lockten in den 1960er Jahren hunderttaussende
Schlachtenbummler zu den GP-Läufen
|
Für zunehmenden
Bekanntheitsgrad der japanischen Motorradmarken sorgte 1964 die
Straßen-Weltmeisterschaft. Das packenste Duell in der 250er Klasse
hieß Jim Redman, auf der hochtourigen DOHC-Vierzylinder-Werks-Honda
gegen Phil Read, auf der simplen Zweizylinder-Zweitakt-Werks-Yamaha. Was
zunächst kaum jemand für möglich hielt, wurde am Ende der Saison
wahr. Als erster Yamaha-Weltmeister und 250er Champion konnte sich Phil
Read in die WM-Chronik eintragen lassen. Honda, damals bereits
weltgrößter Motorradhersteller, fraß sich vor Ärger ein Loch in den
Bauch. Wie schlagkräftig der Yamaha-Twin sogar gegen die brandneue
250er DOHC-Sechszylinder-Werks-Honda war, bewies Phil Read im folgenden
Jahr. 1965 holte er sich und für Yamaha erneut den 250er WM-Titel. |
|
Die schnellste
250er kam 1966 von Suzuki.
Um den Import kümmerte sich Capri Agrati in Köln
|
|
Das Racingflair übertrug
sich automatisch auf die Straßenmodelle. Wer Mitte der Sechziger ein
sportliches Motorrad fahren wollte, kaufte eine 250er Zweitakt-Yamaha.
Große Auswahl gab es allerdings auch nicht. Bis auf eine Ausnahme, die
T20 von Suzuki. Diese 250er hatte es faustdick hinter den Ohren. Man
sprach von 30 PS, 160 km/h Spitze und wie ein echtes Rennmotorrad
verfügte sie über ein Sechsganggetriebe. Klacks testete den Feuerstuhl
auf der Nordschleife und kam zum Schluss:
"Die schnellste 250
ccm-Serienmaschine, die ich bis heute auf dem Nürburgring gefahren
habe". Das war im Herbst 1966. Um den Import kümmerte sich die als
Garelli-Spezialist bekannte Kölner Firma Capri Agrati. Dieser Betrieb
war jedoch weder eine Suzuki-Werksniederlassung noch ein
Tochterunternehem eines japanischen Industriegiganten. Als privater
Importeur versuchte Capri Agrati so gut wie es ging die Suzuki A100, T20
und T500 Titan per Einzelabnahme im Direktverkauf unters Volk zu
bringen. Ein Händlernetz war so gut wie nicht vorhanden. Was den
Kölner Grossisten aber auch nicht weiter störte, denn mit den rund 60
verkauften Maschinen im Jahr hielt er gerademal seinen eigenen Betrieb
am Laufen.
Der Vollständigkeit
halber sei aber noch erwähnt, dass auch die Firma Beckmann in Frankfurt
mit Suzuki Motorrädern handelte. Dabei beschränkte man sich jedoch nur
auf die kleinen A50 und A100 Modelle.
|

Suzuki-Prospekt 1967 von Capri
Agrati
(Suzuki-Prospekt)

Suzuki A100 |

Honda SS50
(Foto:
Honda)

Honda CB450

Hond S800 |
Bei Honda in
Hamburg liefen die Geschäfte zunehmend besser. Das Angebot umfasste
1966 fünf Maschinen: Die SS50, S90, CB125, CB250 und seit neuestem
die CB450. Galt Mitte der Sechziger 500 ccm als magische Zahl für
schwere Maschinen, begnügte sich Honda mit exakt 445 ccm. Und trotzdem,
die CB450 war ein richtiges Motorrad, 200 kg schwer und über 170
Sachen schnell. Eine echte Sensation waren die Drehstabfedern anstelle
sonst üblicher Ventilschraubenfedern im DOHC-Zylinderkopf des 43 PS
starken Viertakt-Twins. Mit dieser Leistung ließen sich sogar
Motorradfahrer in der Königsklasse über 500 ccm locker nass machen.
Mit der Honda CB450 begann eine neue Zeitrechnung, manche sprachen
sogar vom "Meilenstein" in der Motorradgeschichte.
In der Straßen-WM hatte Honda bereits Geschichte geschrieben. Von 1961
bis 1967 heimste das Werk insgesamt sechzehn (!) Titel ein. Einen in der
50er, vier in der 125er, fünf in der 250er und sechs in der 350er
Klasse. Dafür aber keinen in der 500er Klasse. Frustriert darüber,
aber auch um sich verstärkt dem Autogeschäft zuwenden zu können, zog
man sich Ende 1967 aus dem GP-Sport zurück. Mittlerweile war der Name
Honda nämlich auch in der Vierradbranche zum Begriff geworden. Mit den
heute legendären Sportwagen S600 und S800 Coupé machte man den
Anfang. Inzwischen war in der Hamburger Niederlassung Wolfgang Murrmann
tätig, er verkaufte das erste japanische Auto an einen deutschen
Kunden.
|
|
In Punkto
Service mussten die Japaner zunächst viel lernen
|
|
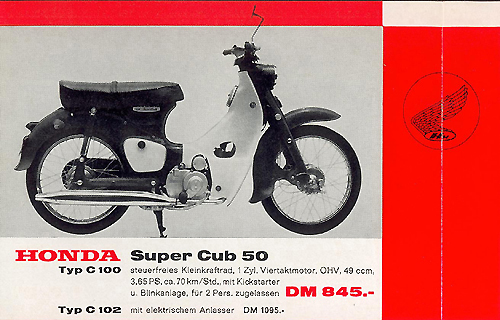
Honda C100 Super Cub 50
Prospekt von 1961
|
Hamburg, auch
"das Tor
zur Welt" genannt, hatte Soichiro Honda mit Absicht als
europäischen Firmensitz ausgesucht. Einmal lag es für die Verwaltung
zentral und zum anderen hatte man den Hafen direkt vor der Tür. Alle
Lieferungen, ganz gleich ob Motorräder, Autos oder Ersatzteile kamen
nämlich via Schiffscontainer auf dem Seeweg in die Metropole. Von Tempo
war hierbei aber keine Rede. Bestellte zum Beispiel ein Händler
Ersatzteile, die im Hamburger Lager nicht vorrätig waren, wurde der
Auftrag zunächst in der Zentrale bearbeitet, dann nach Japan
weitergeleitet, dort wieder durch zig Hände gereicht, die Teile
herausgepickt, verpackt und bei der nächsten Lieferung mit aufs Schiff
gegeben. Und das konnte dauern. Meist Monate, manchmal aber auch ein
halbes Jahr. Längst rannte der verzweifelte Hondafahrer seinem Händler
die Bude ein und der, weil ihm nichts anderes mehr einfiel, erfand die
Ausrede: "...das Schiff ist untergegangen...".
Bei den anderen japanischen Firmen war es allerdings kaum anders, auch
da dauerte es oft ewig, bis die Teile rankamen.
|

(Foto: Röth)
|
Ende der Sechziger war
sowieso noch vieles anders. Technische Schulungen erfolgten in den
jeweiligen Verkaufsgebieten direkt vor Ort. Es wurde ein
Gaststättenraum angemietet, die Händler aus dem Umkreis eingeladen und
die Motoren auf dem Tisch auseinander und wieder zusammengeschraubt.
Etliche Händler kutschierten selbst zum Importeur um ihre bestellten
Maschinen abzuholen.
|
|
|
Ab 1968 nun auch Kawasaki
in Deutschland
|
|

Achtung Suchtgefahr:
Kawasaki A1, 250 ccm und 31 PS
|
|
Neben der Honda
Niederlassung gab es an der Alster einen weiteren Importeur, der damals
gleichzeitig auch größter Motorradhändler Deutschlands war, die Firma
Detlev Louis in der Rentzelstraße 7. Hier hatte man sich auf englische
Bikes spezialisiert, allen vorweg BSA. Anfang der 1960er Jahre war die
englische Edelmarke sogar weltweit größter Motorradhersteller. Die
Geschäftsräume bei Louis waren modern und großzügig eingerichtet,
kein Vergleich zu vielerorts üblichen Hinterhofschrauberbuden, die es
noch zur Genüge gab. Als hanseatischer Kaufmann hatte Detlev Louis
seinen Betrieb picobello durchorganisiert. Diese Gründlichkeit war
offensichtlich auch japanischen Geschäftsleuten aufgefallen. Ende 1967
standen jedenfalls plötzlich drei Herren aus dem Land der aufgehenden
Sonne im Geschäft. Was sie auf dem Herzen hatten, teilten sie Detlev
Louis unumwunden mit, sie suchten für Deutschland einen potentiellen
Kawasaki Importeur.
|
|
Der
Vollständigkeitshalber sei jedoch erwähnt, dass das
Versandhaus Neckermann in Frankfurt bereits 1966 einige der kernigen
650er Kawasakis
W1
Viertakt-Twins
nach Deutschland importiert hatte. Zu den ersten Vertragshändlern
gehörte damals
Anton Wolf aus Seligenstadt. Bis 2005 blieb Anton Wolf der
japanischen Marke treu. In der Szene machte er sich
als der "Kawa-Toni" einen Namen. |

Anton "Kawa-Toni" Wolf |
|
|
Schnell wurden sich
die Asiaten und Detlev Louis handelseinig und bereits ab
Frühjahr 1968 konnte der Hamburger fünf Kawasaki Modelle anbieten: F2
175, A1 250 Samurai, A7 350 Avenger, W1 650 und W2SS 650. Bei der F2
handelte es sich um die 175 ccm drehschiebergesteuerte
Einzylinder-Zweitakt-Einstiegsdroge in die Kawa-Welt. Einstiegsdroge
deswegen, weil die beiden anderen Zweitaktgeschosse A1 und A7 süchtig
machen konnten. Süchtig nach Beschleunigung und Geschwindigkeit. Die
250er A1 leistete 31 PS und war knapp 170 km/h schnell, die 350er A7 mit
satten 42 PS rannte sogar 185 Sachen. Nachdem Klacks im Sommer 1968 die
A1 getestet hatte, hielt er mit seiner Meinung natürlich nicht hinter
dem Berg: "...Diese Drehschieber aber hatten unsere
Motorradbegeisterten schon wieder ganz wild gemacht, und es wehten
gleich die tollsten Sagen durch die Lande, so dass in den
Gesprächsrunden plötzlich die schlitzgesteuerten Zweitakter von Suzuki
und Yamaha unter ferner liefen eingestuft waren. Mensch, zwei
Drehschieber! Für jeden Zylinder einen - ! Das klang nach verkappter
Rennmaschine...".
|
|

Kawasaki 650 W2SS
|
|
Genau das Gegenteil waren
die 650er W1 und W2SS. Hierbei handelte es sich um freche BSA A7 Kopien,
die in Japan zwar hohes Ansehen genossen, sonst allerdings nur müdes
Lächeln verursachten. Mit den Zweitaktern ließ sich ein gutes
Geschäft machen, von den 650er Dampfhämmern brachte man nur sieben
Fahrzeuge an den Mann.
Bei der Zulassung, auch
die Kawas mussten jeweils per Einzelabnahme durch den TÜV gebracht
werden, und dem Vertrieb profitierte Detlev Louis von seiner
langjährigen Erfahrung mit den englischen Bikes. Ein Teil der
Händlerschaft ließ sich als Kawasaki-Partner gewinnen, andere wurden
angeworben. Zu den Pionieren gehörten Spaett in München, Heinrich
Ronsdorf in Schwelm, Reinhard Scholtis in Köln, Motorrad-Bangert in
Bielefeld und Motor-Rauscher in Weißenberg.
|

Optisch wie eine BSA A7, in Wirklichkeit
aber die Kawasaki W1 und W2 |
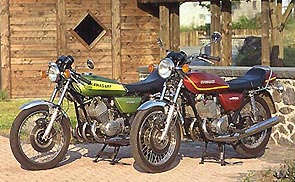
Bürgerschrecken der 70er
Jahre:
Die Kawasaki 500 H1 "Mach III" |
|
Der
Name Kawasaki stand von Anfang an für starke und schnelle Maschinen. Es
sollte aber noch dicker kommen. Anfang 1969 brachten die Japaner die 500
H1 "Mach III" auf den Markt. Wieder ein Zweitakt-Geschoss, nun
aber mit 500er schlitzgesteuertem Dreizylinder-Motor, 50 PS stark und
200 km/h schnell. Wau! Schon am 16. April scheuchte Klacks eine
Testmaschine von Detlev Louis über den Nürburgring. Es war die
"stärkste Serien-500er, die der Markt zu bieten hatte". Auch
kein Wunder, denn "...aus dem Stand kam man bis 100 km/h in einer
Zeit unter fünf Sekunden... " und "...was natürlich einen
gewitzten Fahrer notwendig machte, der mit dem aufsteigenden Vorderrad
fertig werden konnte...". Etwas Vergleichbares hatte es bisher noch
nicht gegeben. Ein Straßenrennmotorrad für Jedermann, und das zu einem
Preis von nur 4300 Mark.
|
|
Als 1969 Honda die
CB750 Four auf den Markt brachte,
sprach die Welt vom "Meilenstein" in der Motorradgeschichte
|

Honda-Mann der ersten Stunde:
Wolfgang Murrmann |
Das war aber längst
nicht alles, was 1969 auf uns zukam. Zeitgleich hatte Honda die CB750
Four fertig. Bereits Anfang 1968 war die Honda-Niederlassung von Hamburg
nach Offenbach-Rumpenheim umgezogen. Verantwortlich für den
Motorradbereich war inzwischen bereits erwähnter Wolfgang Murrmann. Im
Vergleich zu heute waren Ende der Sechziger pompöse Pressevorstellungen
kein Thema. Ganz im Gegenteil. Als im Februar 1969 die erste CB750 Four
nach Rumpenheim kam, durfte, oder anders gesagt, sollte keiner damit
fahren. Sie war als Ausstellungsmaschine bei den Händlern bereits fest
verplant. Doch irgendwie hatte es Klacks spitz bekommen. In einer "Nacht-und-Nebel-Aktion"
und dazu bei Schneetreiben jagte der Obertester die taufrische Maschine
über die Autobahn. In seinem Bericht schrieb er "vom Ritt auf einer
Apollo-8-Rakete", schwärmte von der sagenhaften Beschleunigung,
dem vibrationsarmen Motorlauf des Vierzylindertriebwerkes und der
scharfen Scheibenbremse am Vorderrad.
|
|
Mit der 650 XS1 brachte
Yamaha 1970 ihr erstes Viertakt-Bike
|
|
Jetzt fehlte eigentlich
nur noch Yamaha mit einer heißen Neuigkeit. Und die kam Anfang 1970 in
Form der XS1. Nach britischem Vorbild hatten die Yamaha Techniker ihr
erstes Viertakt-Motorrad als 650er OHC-Parallel-Twin konzipiert. Diese
XS1 mit einer wunderschönen Duplex-Trommelbremse im Vorderrad sollte
allerdings das einzige Exemplar bleiben, das nach Deutschland kam. Um so
verständlicher, dass sich die Mitsui Leute kaum für einen Testbericht
begeistern konnten. Dennoch schaffte es Klacks mit einer List die
Herrschaften samt des neuen Dampfhammers an den Nürburgring zu locken:
Ein Baron Rothschild aus Paris wollte unbedingt die neue Yamaha Probe
fahren. Anstelle des superreichen Adligen stand jedoch Klacks am
verabredeten Treffpunkt. Nachdem die Finte aufgeflogen war, lachten alle
und Manfred Weihe stellte sich sogar spontan als Fotomodell zur
Verfügung.
|

Yamaha 650 XS1 |
|
Anfang der 1970er Jahre
begann ein neuer Motorrad-Boom
|
|
Das neue Jahrzehnt hatte
gut begonnen. Motorräder genossen langsam aber sicher einen anderen
Stellenwert. Es waren keine "arme-Leute-Fahrzeuge" und "alte
Stinkemöhren" mehr, sondern Sportgeräte, mit denen sich in der
Freizeit tolle Abenteuer erleben ließen. Für die Heizerfraktion gab es
die Kawasaki Mach III, für die Gentlemen die Yamaha XS2, Nachfolgerin
erwähnter XS1 und wer Business-Klasse fahren wollte, stieg auf die
Honda CB750 Four. Denn dieses Motorrad setzte tatsächlich neue
Maßstäbe und wurde so zum ersten "Meilenstein in der
Motorradgeschichte". Eine Vierzylinder-Großserienmaschine mit so
geballter Technik hatte es schließlich noch nie gegeben. In einer Zeit,
als "Schrauben am Straßenrand" noch gang und gäbe war,
überzeugte die CB750 Four durch unverwüstliche Zuverlässigkeit.
Wolfgang Murrmann hoffte im ersten Jahr 30 CB750 verkaufen zu können,
am Ende waren es fast 400 Maschinen. Aber auch nur deswegen, weil man
einfach nicht mehr herbei brachte.
|

Vorstellung der neuen Suzuki GT750
Gunter Sachs, links und Fritz Röth, rechts
(Foto: Archiv-Röth)
|
|
Wo man ganz und gar nicht
in die Puschen kam, war bei Suzuki. Capri Agrati in Köln wurstelte vor
sich hin, nichts ging. Was die Marke unbedingt brauchte, war schleunigst
ein neuer Importeur. Die Weichen hierfür waren bereits Ende 1969
gestellt. Fritz Röth, wir kennen ihn bereits als einen der ersten Honda
Händler, hatte sich seit 1964 als Moto Guzzi Importeur einen guten
Namen gemacht. Gemeinsam mit Frankonia-Inhaber Wildberger, er war für
den Suzuki-Import in der Schweiz zuständig, reiste der Odenwälder nach
Hamamatsu ins Suzuki-Stammwerk. Als er zurückkam, war der Vertrag
unterschrieben. Da aber gut Ding Weile braucht, dauerte es noch bis Ende
1971, bis die Firma Zweirad Röth in Hammelbach offiziell als Suzuki
Generalimporteur starten konnte. Für die Saison 1972 standen acht
Modelle im Angebot. In der Viertelliterklasse gab es den Twin T250,
dann folgten die Dreizylinder-Modelle GT380, GT550 und GT750, auch
als "Wasserbüffel" bekannt. Sondermodelle waren die RV50 und RV90, niedliche Knubbel-Bikes mit dicken Ballonreifen. Für die
aufkommende Geländefraktion gab es die Enduros TS125 und TS250. Den
Vertrieb verknüpfte man mit den rund 100 Moto Guzzi-Vertragshändlern.
Alle Suzukis wurden von Zweitaktmotoren angefeuert, die robust,
langlebig und unkompliziert waren. Und wenn doch mal etwas kaputt ging,
waren sie schnell repariert. Beispielhaft war das Baukastensystem, es
sparte bei den Händlern Lagergröße und Kosten für die Ersatzteile.
|
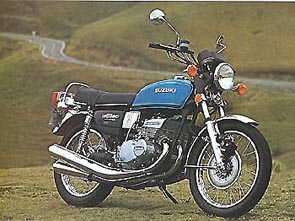
Suzuki GT380
(2 Suzuki-Prospektfotos) |

Suzuki RV50 |
|
Nun waren die "vier
großen" eigentlich komplett. Honda in Rumpenheim bei Offenbach,
der Yamaha-Vertrieb im Hause Mitsui in Düsseldorf, die Technik bei
Manfred Weihe in Löhne, Kawasaki bei Detlev Louis in Hamburg und seit
neuestem Suzuki bei Fritz Röth im Odenwald. Doch das eigentliche
Geschäft ging jetzt erst richtig los. Ein wahrer Motorrad-Boom war
entstanden, kaum ein anderer Wirtschaftszweig konnte von Jahr zu Jahr
über 200 Prozent Zuwachsrate vermelden. Da kam keiner mit, weder BMW
noch die italienische, und die englische Motorradindustrie schon ganz
und gar nicht. Die waren eh schon pleite. Und weil das Ganze für die
Europäer so fürchterlich schlimm war, sprach man plötzlich von der
"gelben Gefahr".
Der japanische Vormarsch
war jedoch nicht mehr zu bremsen. 1974 wechselte Honda zum zweiten Mal
den Geschäftssitz und zog von Rumpenheim nach Offenbach in die
Sprendlinger Landstraße 166. Ende 1975 kündigte Kawasaki Detlef Louis
den Importeursvertrag und eröffnete ab 1976 eine eigene
Werksniederlassung in Frankfurt, die seit 1981 in einem Neubau in
Friedrichsdorf beheimatet ist. Bei Suzuki sollte der Auftritt der
Japaner noch etwas dauern. Zunächst verlagerte Fritz Röth 1976 den
Importsitz auf Drängen des Mutterhauses in Japan von Hammelbach nach
Heppenheim und gründete die "Suzuki Motor Deutschland". Aber
bereits am Ende der Saison stieg Röth, mehr oder weniger unfreiwillig,
aus dem Geschäft aus. In Japan war man nämlich der Meinung, mit einem
neuen Partner mehr Motorräder in Deutschland verkaufen zu können. In
der deutschen "Suzuki Motor Handels GmbH", die zu 50 Prozent von
Otto de Crignis, dessen Familie ein großes Autohaus in München besaß,
und zur anderen Hälfte vom niederländischen Suzuki Importeur Louwman
gehalten wurde, wehte ab 1977 ein frischer Wind.
Rückwirkend darf aber
von der Arbeitsdevise "Quantität statt Qualität" gesprochen
werden. Bei über 60 Modellen verloren nicht nur die Händler, sondern
auch die Macher in der Zentrale, die inzwischen in München residierte,
den Überblick. Ab Anfang der Achtziger rutschte "die große
Suzuki-Familie", wie zu Röths Zeiten immer gesagt wurde, immer
tiefer in die Kriese. Als Ausweg blieb nur der Eingriff vom Stammwerk.
Ab Oktober 1984 kam das Management direkt aus Japan und brachte mit
einem kleinen Stab engagierter Mitarbeiter die neugegründete "Suzuki
Motor GmbH Deutschland", nun wieder mit Sitz an der Bergstraße, in
frisches Fahrwasser. Der Erfolg spricht für diese Entscheidung.
Bei Yamaha blieb im
Prinzip eigentlich alles, wie es immer war. Nur, die Technische Abteilung
und die Verwaltung haben mittlerweile ihre
neuen Büros in Neuss bezogen.
Trotz der gewaltigen
Expansion auf dem deutschen Motorradmarkt sind einige ehemaligen "Macher"
bis auf den heutigen Tag ihrem Beruf treu geblieben. Manfred Weihe ist Vizepräsident
der "Yamaha Motor Deutschland GmbH" in Neuss, die Firma Detlev
Louis in Hamburg gehört zu den größten Motorradzubehörgrossisten in
Europa und Fritz Röth pflegt weiterhin sein erfolgreiches
Motorradgeschäft mit Importhandel verschiedener Marken in Hammelbach im
Odenwald.
|
|