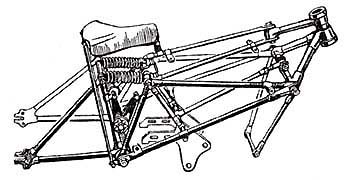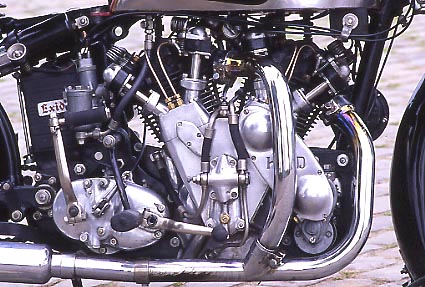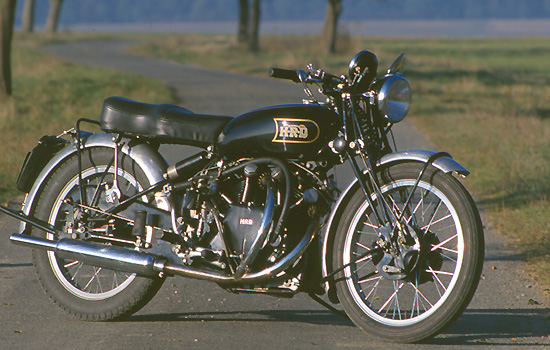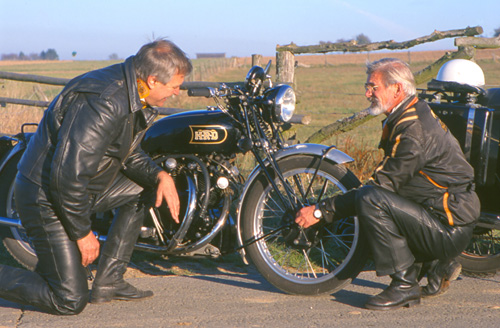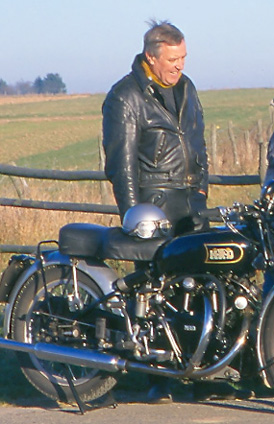|
Motorrad-Marken |
|
Vincent 1000 Black Shadow von 1948 und Vincent 1000 Black Prince von
1955
"Gentleman & Speedmaster"
In den 1950er Jahren war Philip C.
Vincent Englands exklusivster Motorradhersteller. Mit der Black Prince
brachte der geniale Konstrukteur 1955 weltweit das erste Motorrad mit
einer Fiberglas-Vollverkleidung
auf den Markt. Für den legendären
Ruf der Firma jedoch sorgte bereits
ab 1948 die sagenhafte Black Shadow. Die Vincent-Ära hindes dauerte
nicht lange, im Dezember 1955 rollte das letzte
Nobelbike, es war eine
Black Prince, aus den geheiligten Hallen in Stevenage.
Text: Winni Scheibe
Fotos: Winni Scheibe, Vincent-Archiv Kurt Schupp |
|

Bernd Stutz und Manfred Kinne
Vincent Black Shadow von 1948 und Vincent Black Prince von 1955
|
|
Motorradfahren
und Motorrad fahren ist längst nicht das Gleiche. Besonders in schlechten
Zeiten. Bei uns war man nach Kriegsende zunächst mit dem Wiederaufbau
beschäftigt. Zwar blühte bald der Zweiradmarkt, doch das Angebot waren
durch die Bank weg "Brot-und-Butter-Maschinen". Preisgünstige und
robuste 98er, 125er, 200er und 250er Kräder, für den täglichen Weg ins
Büro, zur Arbeit oder in die Lehre. Wer von einer schweren Maschine
träumte, konnte sie an einer Hand abzählen: NSU OSL, Zündapp KS601
sowie die 500er und 600er BMW. An englische Maschinen war nicht zu denken. Erstens gab es
kaum jemand, der sich um den Import kümmerte, und zweitens waren die
"Ladies" viel zu teuer. Doch davon "spinnen" war nicht verboten. Wenn
sich die Motorradfreunde nach getaner Arbeit am Stammtisch oder am
Wochenende ums Lagerfeuer trafen, wurde kräftig "Benzin geredet". "Das
MOTORRAD" war für sie die Bibel, und die Berichte von Ernst "Klacks" Leverkus galten als Offenbarung. Immer wieder brachte der Testguru die
Gemüter in Wallung. 1955 mit den "Supervögeln": 650er Ariel Huntmaster,
650er Triumph Thunderbird und 1000er Vincent Black Prince. Auch für
"Klacks" war die Vincent eine Traummaschine. Angeblich gab es in
Deutschland nur fünf Stück davon. In Wirklichkeit gesehen, geschweige
selbst gefahren, hatte er noch nie eine. Dafür war ihr Ruf um so größer:
"Tempo 200 garantiert ab Laden - Wenn du bei dem Tempo einen Maikäfer
auf die Nase kriegst, hast du ein gestanztes Loch im Kopf". Und dann gab
es noch die Story aus Paris: von den acht, die in einem Jahr verkauft
worden waren, erschlugen sieben noch im gleichen Jahr ihre Fahrer. Über
kein anderes Motorrad wurde mehr diskutiert, spekuliert und Geschichten
erzählt als über die Vincent. |
|
Traummaschine in Deutschland

500er BMW R51/3

NSU OSL 601
|
|
Ende 1955 passierte es, Klacks traf Mr. Minor mit seiner nagelneuen Vincent Black Prince. Ein unglaublicher
Donnerbolzen, fast doppelt so teuer wie die 500er BMW, dafür aber mit
1000 ccm, satten 55 PS, einer pechschwarzen, gewaltigen Vollverkleidung
und atemberaubender Beschleunigung: Erster Gang bis 104 km/h, zweiter
Gang bis 136 km/h, dritter Gang bis 175 km/h! Und im vierten Gang? Mr. Minor lachte: "Straßen für den vierten Gang bei sportlicher Fahrweise
gibt es in Europa für diese Maschine kaum!" Und: "Selbst bei Halbgas
bleibe ich noch immer der schnellste Mann auf den Straßen in
Deutschland. Und dann sind 120 Meilen schon viel zu viel - selbst auf
der Autobahn - und das ist noch nicht einmal Höchstgeschwindigkeit, das
sind erst 192 km/h." Spätestens jetzt war jedem klar, warum Klacks
seinen Vincent-Bericht "Trauben, die hoch hängen" nannte.
|
|

Zwar nicht Mr. Minor, sondern Manfred Kinne mit seiner perfekt
restaurierten Vincent Black Prince
|
|
In England konnten die Motorradfans mit Fug
und Recht mächtig stolz auf ihre Fabrikate sein. Schließlich war man
Marktführer. Schwere Maschinen von BSA, Triumph, Ariel, Matchless, Royal
Enfield, Norton, AJS, Scott, Panther, Rudge, Sunbeam, Velocette und
Vincent waren rund um den Globus heiß begehrt. Und nach der berühmten
Edelschmiede Brough Superior hatte sich mit Vincent obendrein auch noch
ein würdiger Nachfolger gefunden. Dass diese Marke einen so guten Ruf
genoss, lag an der Firmenphilosopie. Philip C. Vincent hatte nämlich die
gleiche Einstellung wie sein Automobilkollege Sir Henry Royce, er
verwendete nur das Beste vom Besten für seine teuren Motorräder. Vincent
Maschinen waren schnell, stark und exklusiv.
|
|
Zu neuen Ufern

Vincent 1000 Rapide
|
|
Nur sieben Jahre nach Wiederaufnahme
der Produktion nach Kriegsende, verließen bereits 1952 pro Woche mehr als sechzig
Maschinen das kleine, aber feine Werk in Stevenage/Südengland. Für P.C.V.,
wie er kurz und bündig von Freunden und Bewunderern genannt wurde, war
das allerdings kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Trotz
allgemein gut gehender Geschäfte bekam die Motorradbranche zusehends
Konkurrenz durchs Auto. Für das Geld, was eine 1000er Vincent kostete,
gab es mittlerweile schicke Kleinwagen. Entgegen englischer
Gepflogenheiten war Phil Vincent längst klar, dass sich nicht die
Motorradkundschaft, sondern die Hersteller der neuen Situation anpassen
müssten. Und hierfür gab es nach seiner Meinung nur eine Chance am Ball
zu bleiben: das Motorrad brauchte eine Verkleidung. Mit diesem Thema
hatte sich P.C.V. bereits in den dreißiger Jahren als junger Ingenieur
beschäftigt. Damals wurden Versuchsverschalungen aus Alublech
handgedengelt. Doch zu einer Serienfertigung kam es nicht, der Zweite
Weltkrieg funkte dazwischen, und die Kapazitäten wurden für andere Dinge
gebraucht. |
|

Der Zeit um Meilen voraus:
Vincent Black Prince
|
|
Anfang der Fünfziger machte ein neuartiges Material von sich reden. Es
war ein duroplastischer Kunststoff, aus dem sich Faserverbundwerkstoffe
fertigen ließen. Cromwell, Hersteller des legendären Halbschalenhelms,
verwendete in Großserie diesen glasfaserverstärkten Polyesterharz, auch
Fiberglas oder kurz GFK genannt. Das Außenmaterial bestand aus mehreren
Schichten Glasfasergewebematten, die mit Kunstharz getränkt waren. Die
Fiberglas-Schale wurde handlaminiert und zeigte hervorragende
Eigenschaften. Sie war superleicht, dafür aber außergewöhnlich stabil,
unempfindlich gegen Witterungseinflüsse und Lösungsmittel, ließ sich
individuell lackieren und mit Aufklebern dekorieren.
|

Cromwell-Träger
Jim Redman,
Honda-Werksfahrer
und sechsfacher Weltmeister
(Foto: Archiv-Redman) |
|
|

Vollkommen neuer Werkstoff:
Duroplastischer Kunststoff
|
Und genau
aus diesem Wundermaterial wollte Phil Vincent die Verkleidungen bauen.
Allerdings war in der Motorradbranche so etwas überhaupt noch nicht
gebräuchlich. Vergleichbares, von dem man hätte abspicken können, gab es
also nicht. Der Visionär versprach sich von seiner Idee gleich zwei
gewaltige Vorteile für den Motorradfahrer: Zum einen sollte die
Verkleidung bei Regenwetter den ekligen Straßenschmutz fernhalten und
zum anderen bei schneller Fahrt vor lästigem Fahrtwind schützen.
|
|
|
Zunächst galt es einen Prototyp zu
entwerfen. Aus Holz, Gips sowie Pappmaché wurden ein breiter
Vorderradkotflügel, Motorseitenabdeckungen, eine Hinterradverkleidung,
eine lenkerfeste Oberteilverkleidung sowie Beinschilder, die so geformt
waren, dass sie gleichzeitig den Fahrtwind als Kühlluft auf das
Triebwerk leiteten, modelliert. Diese Modelle dienten zur Herstellung
der jeweils benötigten Negativformen, in die die Glasfasermatten
einlaminiert wurden. Damit die Bauteile über die gesamten Flächen eine
gleichbleibende Wandstärke erhielten, war es jedoch wichtig, dass die
Fiberglasmatten faltenfrei in den Formen lagen und gleichmäßig mit Harz
durchtränkt wurden. Dieses Laminieren verlangte viel Geschick und
gewissenhafte Fertigungsweise, was man sich allerdings erst mühselig
erarbeiten musste. Rund ein Jahr verging, bis man die Sache im Griff
hatte und sich alle GFK-Bauteile passgenau und mit einer tadellos glatten
Oberfläche herstellen ließen. |
|

Auch auf dem Wasser war P.V.C. der Zeit
voraus:
Vincent "Amanda Water-scooter"
(Foto: Vincent-Archiv Kurt Schupp)
|
|
In diesem Zusammenhang sei ein kurzer Einschub erlaubt. P.V.C.
war nicht nur zu Lande, sondern auch auf dem Wasser seiner Zeit weit
voraus. Er konstruierte und baute den ersten "Water-scooter". Das Ding sah wie ein
über die Wasseroberfläche flitzender Delphin aus, auf dem quietschvergnügt ein Menschenkind hocken konnte. Den pfiffigen
Wasserfloh hatten die Vincentleute aus Fiberglas gefertigt, für den
Antrieb sorgte ein kleiner Zweitakt-Motor. So sensationell der "Amanda Water-scooter" aber auch war, so schnell wurde das niedliche
"Speed-boat" ein "Submarine". Erst viele Jahre später "erfanden" Suzuki,
Kawasaki und Yamaha das Spielzeug neu. Bei den Japanern hießen die
Wasserflitzer fortan Wet-Bike, Jet-Ski und Wave-Runner.
|
|

Die Sensation auf der "Earl´s Court Show" in
London:
Vincent Black Prince
|
|
Doch
zurück zur Fiberglas-Idee. Im Herbst 1954 präsentierte die Nobelmarke
bei der "Earl´s Court Show" in London
die vollverkleideten 1000er Tourensportler Black Knight und Black
Prince. Was sich unter den schwarzen Kunststoffhäuten verbarg, wussten
zunächst aber nur Insider. P.C.V. hatte sich nämlich einen geschickten
Schachzug ausgedacht. Als Basis für die Black Knight diente die Rapide
mit 45 PS Motor, und die Black Prince war im Prinzip eine
vollverkleidete Black Shadow mit 55 PS Triebwerk. Die Luxusliner
gehörten zur vierten und letzten Vincent-Generation, der “Serie D“. Die
besonderen Merkmale dieser Baureihe waren: 6-Volt-Batteriezündung,
geänderter Rückgrat-Rahmen ohne integrierten Öltank (das kostbare Öl für
die Trockensumpfschmierung dümpelte nun in einem separaten
Vorratsbehälter), fast liegendes, hydraulisch gedämpftes Mono-Federbein
für die Hinterradschwinge, ein neuer hinterer Hilfsrahmen und nur noch
eine Trommelbremse am Hinterrad. Die hydraulisch gedämpfte
Girdraulic-Gabel gehörte dagegen bereits seit 1948 zur
Standardausstattung.
|
|

Vincent Black Prince Logo
|
|
Bei der Lackierung war damals bekanntlich
alles erlaubt, solange es sich um Schwarz handelte. Und so waren die
Black Knight und Black Prince von vorne bis hinten pechschwarz, nur
rechts und links sorgten je ein dezenter goldener Zierstreifen für "Farbenpracht". Echte Aufregung herrschte dagegen in der Motorradszene.
Solche Maschinen hatte keiner erwartet. Mit diesen extravaganten
Motorrädern wollte Vincent aber nicht nur seine Innovationsfähigkeit
demonstrieren, sondern auch mit dem weitverbreiteten Negativ-Image,
Motorradfahrer seien verdreckte und ölverschmierte Gesellen, Schluss
machen. P.C.V. pries seine neue Kollektion als Tourensport- und
Reisemaschine für bequeme und ermüdungsfreie Langstreckenfahrten.
|
|
Rolls-Royce auf zwei
Rädern

Vollverkleidetes Sporttouren-Motorrad anno
1955 |
|
Trotz der Verpackungskunst hatte der geniale
Konstrukteur aber auch an den praktischen Teil gedacht. Um die
erforderlichen Servicearbeiten zu erledigen, ließen sich mit wenigen
Handgriffen die Seitenverschalungen abnehmen und die
Hinterradverkleidung hochklappen. Hohe Qualitätsmerkmale und eine
sprichwörtliche Wartungsfreundlichkeit waren weiterhin die
herausragenden Eigenschaften der Vincent. Alle Inspektionsarbeiten
konnten problemlos mit dem Bordwerkzeug vom Besitzer selber durchgeführt
werden. War in der damaligen Motorradwelt die Schrauberei am Straßenrand
jedoch ein Muss, erreichte die Vincentfraktion dank der hohen
Zuverlässigkeit ihrer Maschinen sicher jedes Ziel. Und zum Verreisen
waren Knight und Prince geradezu prädestiniert. Als Zubehör gab es einen
Gepäckträger, dazu passende Seitenkoffer aus Kunststoff, ein
Zusatzschild für die Windschutzscheibe und einen ledernen Tank-Überzug.
Serienmäßig hatte dagegen die "Serie D" die Vorrichtung zum Aufbocken.
Via langem Hebel ließ sich das Bike kinderleicht auf den Hauptständer
hieven.
|
|

|
|
Diese
komfortablen "Rolls-Royce auf zwei
Rädern" hätten eigentlich die Oberknaller werden müssen. Doch Phil
Vincent hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Nur wenige konnten
sich für diese neue Art von Motorrad begeistern. Das Gegenteil war sogar
der Fall. Der angestrebte Imagewechsel stieß auf Ablehnung. Die damalige
Motorradwelt wollte weiterhin "open-air" durch die Gegend brausen, und
gegen Nässe und Kälte vertraute man lieber den bewährten Klamotten von Barbour oder Bellstaff. Auch wenn der Begriff
"Plastikschüssel" noch
nicht gebräuchlich war, so waren sich die Experten dennoch einig, eine
Kunststoff- Verschalung hatte am Motorrad einfach nichts zu suchen. Und
so half weder der legendäre Ruf, noch die mutige Innovation. Nur ein
Jahr nach Vorstellung der umstrittenen Black Knight und Black Prince musste die Nobelmarke die Fabriktore für immer schließen. Dabei war
Vincent längst zum Mythos geworden. Die Edelschmiede baute in den
Fünfzigern die schnellsten und teuersten Straßenmotorräder der Welt, für
viele galt die Black Shadow als Traummaschine schlechthin.
|
|
Die Vincent-Saga
 |
|
Begonnen hatte die Vincent-Saga recht früh.
Bereits in seiner Jugend interessierte sich der Sohn eines reichen
argentinischen Rinderfarmers für technische Dinge. 1919, damals war der
Pfiffikus gerade 11 Jahre alt, schickten ihn seine Eltern zum weiteren
Schulbesuch nach England. Mit 14 Jahren bestand er als Bester die
Aufnahmeprüfung zur Ingenieurschule in Cambridge, und kaum 16 Jahre alt
modifizierte er seine 350er BSA mit einer Hinterradfederung. Zwei horizontal liegende Schraubenfedern übernahmen die Federarbeit der
selbst konstruierten und zusammengeschweißten Dreiecksschwinge. Mit
diesem System hatte der junge Vincent 1927 das Vorbild für die von
Yamaha Mitte der siebziger Jahre als Weltneuheit präsentierte "Cantilever-Federung"
erfunden...
|
|
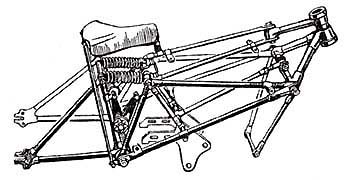
Philip
C. Vincent "Cantilever-Rahmenkonstruktion"
(Foto:
Werk) |
|
Zu jener Zeit lernte er Howard R. Davies,
dessen H.R.D.-Motorräder in England sehr bekannt waren, kennen. Vincent
stieg bei Davies ins Geschäft ein, die dazu benötigten Finanzen lieh er
sich bei seinem Vater. Die beiden Motorradenthusiasten nannten ihre
Firma "The Vincent H.R.D. Company Ltd.", mit Sitz in Stevenage. Man
baute eigene Fahrwerke und bestückte sie mit 250er, 350er, 500er und
600er Triebwerken von Villiers, Rudge und JAP. In puncto Bremsanlage
tüftelte Vincent 1933 etwas ganz Besonderes aus. Jeweils zwei
Halbnaben-Trommelbremsen mit 178 mm Durchmesser sorgten am Vorder- und
Hinterrad für gute Bremswerte. Diese Stopper erwiesen sich als so gut,
dass sie bis zur Firmenschließung beibehalten wurden. Der Fahrzeugverkauf
war mittlerweile gut in Schwung gekommen, und Vincent konnte noch im
gleichen Jahr den bekannten australischen Motorenkonstrukteur Phil
Irving engagieren. Umgehend machten sich die beiden Techniker an die
Konstruktion eines 500er Einzylinder-Viertakt-ohv-Motors. Auf Anhieb war
der Single erfolgreich.
|
|
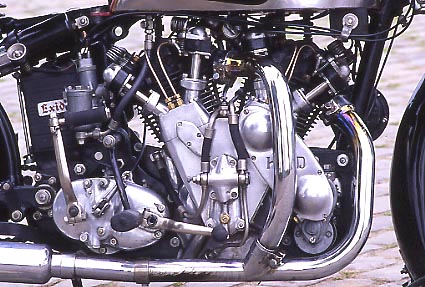
1937 erster 1000er Vincent
V2-Motor: "plumber`s nightmare" |
|
Nur zwei Jahre nach Einführung der neuen
500er Modellgeneration tüftelten Vincent und Irving am nächsten Knüller.
Sie hatten zwei 500er Motoren zu einem 1000er V-Triebwerk zusammengekoppelt. Auf das neue Gehäuse ließen sich pfiffigerweise
Zylinder, Kolben und Zylinderkopf vom erprobten 500er Eintopf stecken.
Gut 45 PS leistete das V2-Aggregat, das kurzerhand in das kaum
veränderte Diamond-Chassis vom Single eingebaut wurde. Die 1000er
Vincent H.R.D. Rapide “Serie A“ sorgte für Schlagzeilen in der
Fachpresse und ließ die Gerüchteküche mächtig brodeln. Die “A-Twin“ war
nämlich das erste Serien-Motorrad der Welt, das über 110 Meilen pro
Stunde (etwa 180 km/h) erreichte. Aber kaum einer erreichte je dieses
Tempo. Wo gab es schon die Straßen, auf denen man eine derartige
Geschwindigkeit hätte fahren können. Und so trauten sich wohl nur ganz
wenige Piloten, den Gashahn bis zum Anschlag voll aufzudrehen. Zum
Glück. Das Triebwerk war nämlich noch nicht ausgereift. Zahlreiche
außen liegende Ölleitungen waren zur Versorgung der lebenswichtigen
Schmierstellen erforderlich. Und da es immer wieder vorkam, daß die
Anschlussstellen leckten, hatte der "A-Twin" bald seinen Spitznamen "plumber`s
nightmare", was soviel wie "Klempners Alptraum" bedeutet, weg. Bis 1939,
als auch England in die Kriegswirren gerissen wurde, hatte man von der
1000er Rapide gerade mal 78 Maschinen bauen können.
|
|

Nur 78 Maschinen wurden von der
ersten 1000er Vincent gebaut |
|
Gleich nach Kriegsende gings in Stevenage
weiter. Zusammen mit Chefkonstrukteur Phil Irving entwickelte Vincent
eine neue Modellpalette, die als Baukastensystem ausgelegt war. In den
Rahmen ließen sich wahlweise der Ein- oder Zweizylinder-Motor einbauen.
Von einem Chassis im herkömmlichen Sinne konnte allerdings kaum die Rede
sein. Hauptbestandteil war lediglich ein stabiles Rückgrat aus
Vierkantrohr, das direkt am Zylinderkopf angeschraubt wurde und das
gleichzeitig als Öltank diente. Die Führung des Vorderrades erledigte
die ungedämpfte Brampton-Trapezgabel. Bei der Hinterradfederung blieb
man bei Bewährtem. Die Lagerung der Dreiecksschwinge war direkt am
Motorgehäuse angeflanscht, und wie vor dem Krieg übernahmen zwei fast
liegende Federelemente die Federarbeit. Nur aus diesen drei Bauteilen -
Trapezgabel, Rückgratrahmen und Dreiecksschwinge - bestand das
Fahrgestell. Der Motor diente als mittragendes Element. Auf die
klassischen Speichenräder war vorne ein 3.25-20 und hinten ein 3.50-19
Avon-Reifen montiert. Die Bremsarbeit übernahmen am Vorder- und
Hinterrad je zwei Trommelbremsen. Baukastensystem war auch bei der
Konstruktion des 500er und 1000er Triebwerkes angesagt. Etliche
Bauteile, wie zum Beispiel Zylinderköpfe, Zylinder, Kolben und viele
Kleinteile, ließen sich in beiden Motoren verwenden. War beim
Einzylinder das Getriebe noch nach echt englischer Sitte hinter dem
Motor angeflanscht, bestand der V2 aus einem Block, in dem das
Vierganggetriebe gleich mit untergebracht war. Beachtlich war die
Kupplung. Da es damals noch keine hochwertigen Materialien gab, bestand
die Kupplung aus zwei Bauteilen: einer über Bowdenzug betätigten
Einscheiben-Trockenkupplung und einer zusätzlichen Servo-Trommelkupplung,
vergleichbar mit einer Trommelbremse. Kuppelte der Fahrer aus, wurden
die vier Kupplungsbeläge in die Trommel gepresst, und so konnte das
enorme Drehmoment des V-Motors verlustfrei an das Getriebe
weitergeleitet werden. Der nächste Clou war der Ventiltrieb. Damit die
Stößelstangen möglichst kurz blieben, waren die beiden über Zahnräder
angetriebenen Nockenwellen hochgelegt, und die Kipphebel betätigten die
Ventile unterhalb der Ventilfeder. Auch auf geringes Gewicht legte man
damals großen Wert. Aus diesem Grund waren Motorgehäuse, Zylinder und
Zylinderköpfe aus Aluminium gefertigt. Die ersten Modelle 1946 waren die
500er Meteor mit 26 PS und die 45 PS starke und 175 km/h schnelle 1000er
Rapide.
|
|

1000er Vincent Black Shadow Motor von 1948
|
|
Genau wie
vor dem Zweiten Weltkrieg beteiligte sich Vincent bald wieder im
Rennsport. Für 1947 entstand die "Gunga Din", mit der Werksfahrer George Brown zahlreiche Rennerfolge
erringen konnte. Die "Gunga-Din" wurde zur Legende und war mit
Sicherheit die wohl schnellste jemals gebaute 1000er V2-Renn-Vincent.
Das Triebwerk hatte man nach allen Regeln der Kunst getunt. Beflügelt
von den Erfolgen beschloss man noch im gleichen Jahr, das gesammelte
Know-how in einer Straßenmaschine unterzubringen Als Basis diente die
Rapide "Serie B". Das Fahrwerk blieb, abgesehen von den
Dunlop-Aluminium-Hochschulterfelgen und zur besseren Kühlung verrippten
Trommelbremsen, serienmäßig. Das Hauptaugenmerk legte die
Vincent-Rennabteilung auf das Triebwerk. Die Pleuel wurden erleichtert
und hochglanzpoliert, Ein- und Auslasskanäle optimiert, scharfe
Rennnockenwellen eingebaut, die Verdichtung von 6,8 auf 7,3 erhöht und
die Standard-Vergaser gegen große Amal-Vergaser vom Typ 279 mit 1
1/8-Zoll Durchlass getauscht. Freizügig konnten die Amal-Vergaser die
Luft durch offene Ansaugtrichter schnorcheln, und fast ungehindert
gelangten die Abgase durch die 2-in-1-Auspuffanlage ins Freie. Das
Standard-Getriebe ersetzte man gegen ein Renngetriebe mit extrem langen
ersten Gang. Das Tuning konnten sich sehen lassen, die Leistung
kletterte von 45 PS auf beachtliche 55 PS bei 5700/min. Zur besseren
Wärmeabfuhr ließ sich Vincent etwas Interessantes einfallen: Das
Triebwerk wurde in einem Spezialverfahren schwarz lackiert. |
|
Schwarz wie die Nacht und schnell wie der Schatten:
Vincent Black Shadow
|
|

|
|
Eine weitere
Besonderheit dieser Supersportmaschine wurde der riesige Smiths-Tacho,
dessen Skala in der "Meilenausführung" bis 150 und mit der
"Kilometereinteilung" bis 250 Sachen reichte. Auf dem Tank klebte mit
dicken Lettern das "H.R.D."-Logo, und vorne am Steuerkopf gab es einen
Aufkleber mit dem geflügelten Götterboten Merkur, Symbol für
Schnelligkeit und Kraft. Und weil das Bike schwarz wie die Nacht und
schnell wie der Schatten war, wusste man auch gleich einen Namen: Black
Shadow. |
|
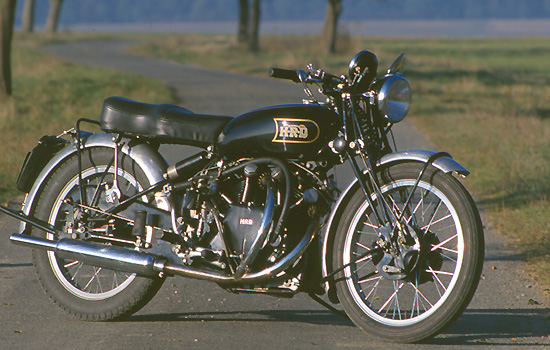
Schon zu Bauzeiten eine Legende:
Vincent Black Shadow Serie B
|
|
Anfang 1948 kam die Vincent Black Shadow
"Serie B" auf den Markt. Dank
des niedrigen Schwerpunktes verfügte die "zulassungsfähige Rennmaschine"
über ein ausgesprochen gutes Handling. Eingefleischte Fans schwärmten
sogar von exzellenten Fahrwerksqualitäten: Draufsetzen, sich wohl fühlen
und losdüsen. Dabei musste die ersten Black Shadows "Serie B" sogar noch
mit der spindeldürren ungedämpften Brampton-Trapezgabel vorlieb nehmen.
Auch die Hinterradfederung arbeitete ohne hydraulischen Dämpfer.
Lediglich einstellbare Reibungsdämpfer minderten in der Trapezgabel und
für das Hinterrad das unkontrollierte Nachschwingen der Federelemente.
Doch welches Motorrad verfügte Anno 1948 schon über einen Federrahmen.
In einer Zeit, in der etliche Experten noch steif und fest davon
überzeugt waren, dass nur Fahrwerke mit starrer Hinterachse eine optimale
Straßenlage vermitteln können. |
|

Bernd Stutz auf seiner Vincent Black Shadow
von 1948
|
|
Vincentfahrer standen über diesen Dingen. Besonders, wenn es um
Beschleunigung und Durchzug ging. Im großen Gang ließ sich der "Schwarze
Schatten" ruckfrei ab 50 Knoten in wenigen Augenblicken bis auf über 200
km/h katapultieren. Wer damals den Akteur aber nach dem Topspeed fragte,
bekam in der Regel die coole Antwort: "Weit über 120 Meilen pro Stunde".
Wo allerdings der verwegene Reiter dieses Tempo "erfahren" hatte, konnte
oder wollte er nicht verraten. Geeignete Autobahnen, die für diesen
Affenzahn geschaffen waren, gab es kurz nach Kriegsende ja noch nicht.
Doch sei es, wie es will. Wer mit der 1000er Vincent H.R.D. Black Shadow
"Serie B" unterwegs war, war "King of the Road". Kein anderes Bike war
schneller.
|
|

|
|
Die Kunde über diese Supermaschine
verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Ein Mythos war geboren, die Black Shadow wurde zur Traummaschine einer ganzen Motorradfahrergeneration.
Allerdings nur wenige konnten sich diesen Traum erfüllen. Lediglich 80
Black Shadows von der "Serie B" verließen das Werk.
|
|

Vincent on Tour:
Black Shadow und Black Prince
|
|
Und nun zum Schluss, doppelsinnig sogar. Für
Phil C. Vincent war die Motorradfertigung ein kostspieliges Unterfangen.
Bei jeder Maschine legte er gut 200 Mark drauf. Und so wundert es nicht,
dass bereits 1950 das Unternehmen bei den Banken mit rund 2,2 Millionen
Mark in der Kreide stand. Zwar versuchte man mit Fremdaufträgen und
Entwicklungsarbeiten sich über Wasser zu halten, doch das Ende war
unabwendbar. Auch die beiden superlativen Modelle Black Knight und Black
Prince konnten die Firma nicht mehr retten. Von den beiden
Fiberglas-Bikes wurden jeweils nur 150 Maschinen gebaut. Am 18. Dezember
1955 verließ die letzte Vincent, eine Black Prince, das Werk in
Stevenage.
|
|
"Schattenreiter & Königssohn"
Was zwei Vincentfahrer über ihre Maschinen
sagen
|
|
Für die Vincent-Story brachte Bernd Stutz
seine Black Shadow
von 1948 und Manfred Kinne seine Black Prince von
1955 mit.
Eines der herausragenden Merkmale dieser Nobelräder ist ihr
Baukastensystem. Black Shadow und Black Prince basieren auf
dem gleichen
Konstruktionsprinzip und doch sind sie grundverschieden. Die eine ist
ein kompromissloser Supersportler, die andere eine komfortable
Tourenmaschine. In den fünfziger Jahren waren
Vincent Motorräder
Traummaschinen, sie haben an Ausstrahlung
und Faszination nichts verloren.
|
|
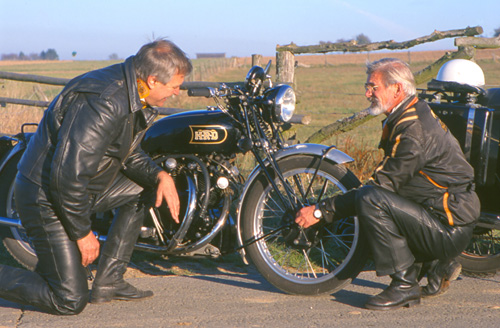
Vincent-Experten: Bernd Stutz und Manfred
Kinne |
|
Als direkter Ableger der legendären Gunga-Din war die Black Shadow
eigentlich das erste Superbike. Eine Rennmaschine mit Straßenzulassung,
gebaut um möglichst schnell von A nach B zu kommen", erzählt Bernd Stutz
über seinen schwarzen Schatten.
|
Ein
Motorrad ohne Schnickschnack, mit Technik zum Durchgucken, stark,
schnell und mit Fahrleistungen, die für damalige Verhältnisse
unvorstellbar waren. Das Getriebe ist rennmässig
abgestuft, den ersten Gang kann man bis über 100 km/h ziehen. Dabei lässt
die Fahrbarkeit keine Wünsche offen. Ist der vierte Gang eingelegt,
bestimmt die Gashand das Tempo, selbst in Ortschaften braucht man nicht
runterschalten. Mit gewaltigem Schmackes drückt der Motor auch aus
niedrigen Drehzahlen mächtig vorwärts. Auf kurvenreichen Nebenstraßen
ist die Black Shadow voll in ihrem Element, hier überzeugt das mächtige
Drehmoment und vermittelt einen enormen Fahrspaß. Sitzposition,
Handling, Bremsen - alles stimmt. Sind die Reibungsdämpfer vorgespannt,
ist die Straßenlage hart, aber gerecht. Waren es früher die schlechten
Straßen, die das Ausfahren der Black Shadow kaum zuließen, wird heute
das Fahrvergnügen von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsdichte
eingeschränkt. Auf Land- und Bundesstraßen fühlt man sich zwischen 90
bis 130 Sachen am wohlsten, auf der Autobahn liegt das Dauertempo
zwischen 140 bis 160 Stundenkilometer. Begleite ich Kollegen mit ihren
brandneuen Maschinen, ist die 50 Jahre alte Vincent längst nicht die
Letzte."
|
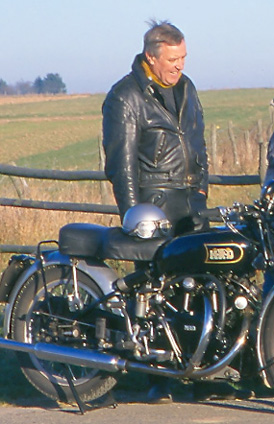
Black Shadow Besitzer Bernd Stutz |
|
|

Black Prince Besitzer Manfred Kinne |
Über die
Fahrleistungen braucht Manfred Kinne kein Wort zu verlieren.
Schließlich ist die Black Prince eine vollverkleidete
Black Shadow und noch dazu aus der letzten Modellgeneration, mit
hydraulisch gedämpfter Trapezgabel und Hinterradfederung, was die
Fahrwerksqualitäten noch einmal deutlich verbesserte. "Für damalige
Verhältnisse wies die Verkleidung sicherlich mutige Formen auf. Doch
das, worauf es ankommt, erfüllt sie," betont Manfred Kinne.
|
|
|
Oberteilverkleidung
und Beinschilder schützen wirkungsvoll vor Wind und Wetter. Die lange
Sitzbank ist ausgesprochen komfortabel, große Touren lassen sich bequem
zurücklegen. Für die Langstreckentauglichkeit wurde der Tank extra von
16 auf 18 Liter Fassungsvermögen vergrößert. Bei einer
Reisegeschwindigkeit von 130 bis 140 km/h verbraucht die Black Prince
lediglich 5,5 Liter Normalbenzin, was eine Reichweite von über 300
Kilometer ermöglicht. Auch die Motorverschalung hält den Straßenschmutz
wirksam dem Triebwerk fern. Für Putzteufel ist die Black Prince
allerdings keine Herausforderung. Ein Eimer mit Shampoowasser und ein
Waschschwamm genügen, und sie ist ruckzuck wieder blitzblank. Wie weit
Vincent seiner Zeit voraus war, zeigen Detaillösungen", lässt Manfred
Kinne wissen, "Das Bremslicht wurde über die Vorderradbremse aktiviert. P.C.V. war nämlich der Meinung, routinierte Motorradfahrer
gebrauchen sowieso nur die Vorderradbremse, da dieser Stopper die meiste
Verzögerungsarbeit übernimmt. Aus diesem Grund hat er auch ab der
Serie-D auf die zweite Trommelbremse am Hinterrad verzichtet. Die
Fußrasten lassen sich individuell verstellen, und eine echte
Errungenschaft waren Gepäckträger und Seitenkoffer. An solch´ ein
Zubehör dachten andere Hersteller erst über dreißig Jahre später."
|
|
Text-Archiv:
Vincent
|