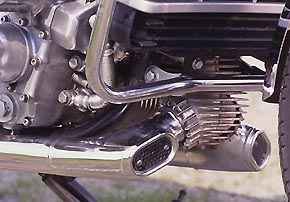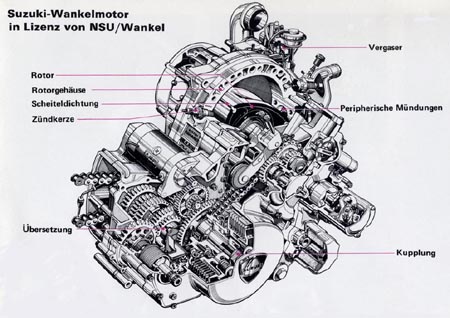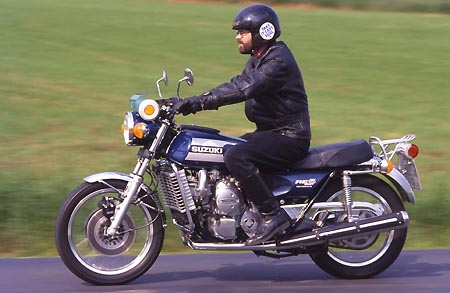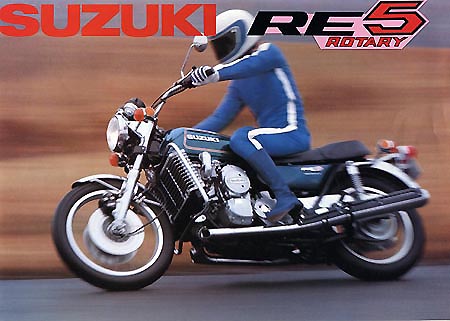|
Suzuki RE5 Rotary
"Rotary-Club"
In den sechziger und
siebziger Jahren scheute die japanische
Motorradindustrie vor keinem
Experiment zurück. Man entwickelte
hochmoderne Zwei- und Viertakter als
Ein- oder Mehrzylindermotoren.
Nichts schien unmöglich. Sogar
Wankeltriebwerke wurden ausprobiert.
In Serie ging allerdings das
Wenigste. Nur bei Suzuki hatte man
Großes vor, die RE 5 Rotary sollte
das Topmodell werden. Ein
Wunsch, der sich leider nicht erfüllte. Die
RE5 war erprobt und
serienreif, als Verkaufsknüller wurde sie jedoch
zum Flop!
Text: Winni Scheibe
Fotos: Scheibe, Werk
|
|

|
|
Wird
von echten Motorradfahrern gesprochen, weiß man eigentlich sofort,
welche Generation gemeint ist. Nämlich die, die per Kickstarter den
Motor in die Gänge brachten. Die Technik kannten sie natürlich in- und
auswändig, auch konnte mit verbundenen Augen die Maschinerie auseinander-
und wieder zusammengeschraubt werden. Eine Panne unterwegs bedeutete
eine Herausforderung, selber reparieren und die Kunst des Improvisierens
am Straßenrand gehörten zum Alltag. Es war die Zeit, als Ernst "Klacks"
Leverkus den "gelben Schal" erfand. Blieb einer mit einem
Defekt liegen, wurde das gelbe Halstuch einfach ans Lenkerende gebunden.
Vorbeikommende Motorradfahrer wussten dann sofort: der Kollege braucht
Hilfe. Und es wurde geholfen!
Die Störanfälligkeit bezog sich
jedoch nicht auf eine Marke oder einen speziellen Typ. Im Prinzip waren
vor rund 40 Jahren alle Motorräder ausgesprochen pflege- und wartungsintensiv.
Ständig musste nach dem Rechten gesehen werden. Wer dies
vernachlässigte oder schlamperte, kam nicht weit. Zu bedauern waren die
damaligen Motorradfahrer jedoch nicht. Sie hatten sich ihr Hobby
freiwillig ausgesucht. Für das Geld, das sie dafür ausgaben, hätten
sie sich auch locker ein Auto kaufen können. Doch genau das sollte es
ja nicht sein, man fuhr schließlich Motorrad, weil man wollte und
nicht, weil man es musste. Viele waren es allerdings nicht, der
Motorradmarkt lag nämlich kärglich am Boden. Bei uns jedenfalls. Ganz
anders in den USA. Hier tobte ein gewaltiger Zweirad-Boom. Für
Aufregung sorgten allen vorweg japanische Flitzer. Honda prahlte sogar
mit dem Werbeslogan "You meet the nicest people on a Honda".
Es dauerte dann auch nicht mehr lange und der Bazillus erreichte Europa.
Die Honda CB 750 Four wurde 1969 nicht nur zum Meilenstein in der
Motorradgeschichte, die sensationelle Vierzylindermaschine läutete eine
vollkommen neue Motorradgeneration ein. Was bis vor kurzem kaum ein
Mensch für möglich gehalten hatte, war plötzlich wahr geworden. Man
brauchte sich nur auf die Honda drauf zu setzen und ab ging die Post.
Weder stundenlanges Werkeln, bevor es endlich losging, noch Pannen
unterwegs trübten den Fahrspaß. Hinsichtlich ihrer Fahrleistung,
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sollte die Honda CB 750 für die
nächsten Jahre zum Maß der Dinge werden. So etwas hatte es bis dahin
noch nie gegeben.
|
|
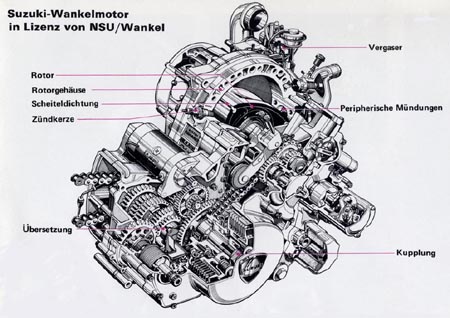
Rundes-Ding: RE5-Triebwerk
(Foto:
Werk)
|
|
Doch
es sollte noch viel besser kommen. In einer regelrechten Modell-Flut
überschwemmten Anfang der Siebziger die japanische Hersteller den
Markt. Kaum eine Marktlücke wurde ausgelassen und die, die es noch
nicht gab, wurde einfach neu erfunden. Die Maschinen wurden von Jahr zu
Jahr laufend stärker, schneller und schwerer. An ihrer Zuverlässigkeit
gab es schon bald kaum noch etwas auszusetzen, die Bezeichnung "japanischer
Standard" wurde zum Qualitätszeichen. Im gegenseitigen Wettrüsten
versuchte einer den anderen zu überflügeln. In diesem Erfolgsrausch
experimentierten die Versuchs- und Entwicklungsabteilungen auch mit
Kreiskolbenmotoren oder, wie nach seinem Erfinder benannt, dem
Wankelmotor.
Kein anderes Triebwerk stellte eine größere Herausforderung dar.
Bewegliche Bauteile, wie Kolben, Pleuel, Ventile, Kipphebel, Stößel
und Nockenwellenbetätigung gab es nicht. In einem "eiförmigen"
Innenraum, der sogenannten "Trochoide", drehte sich ein
Kreiskolben. Der auch als "Rotor", "Läufer" oder
"Scheibe" bezeichnete Kolben war allerdings nicht wie beim
Zwei- oder Viertaktmotor rund, sondern "dreieckig" und
verfügte über drei Arbeitskammern. Die rundumlaufende Bewegung des
Kreiskolbens in der Trochoide ermöglichte eine Exzenterwelle, die die
Drehbewegung über die Kupplung ans Getriebe weitergab. Jegliche hin-
und hergehenden Bewegungen, die man vom Zwei- und Viertaktmotor her
kannte, kamen im Wankelmotor also nicht vor. Die Arbeitsweise des
Wankelmotors entsprach jedoch einem Viertakter: Ansaugen, Verdichten,
Arbeiten und Ausstoßen. Pro Kolbenumdrehung erfolgen dafür aber drei
Arbeitstakte. Im Vergleich zu bekannten Otto-Motoren mit ähnlicher
Leistungsabgabe war das Wankeltriebwerk dagegen wesentlich kompakter,
war leichter und auch kleiner.
|
 |
 |
|
Keine
Frage, dass der in den sechziger Jahren bei NSU zur Serienreife
entwickelte Wankelmotor eine wahre Kreiskolben-Euphorie auslöste.
Techniker, Visionäre und Wankel-Fans prophezeiten bereits das Ende vom
Hubkolben-Motor. So logisch und einfach das System allerdings auch war,
so gewaltig waren die Probleme, mit denen sich die Ingenieure in den
kommenden Jahren noch auseinanderzusetzen hatten. Es waren nicht nur
die extrem hohen Temperaturen am Rotor, auch das Abdichten des
Kreiskolbens sowie die Nebenaggregate Zündanlage und
Gemischaufbereitung im Vergaser waren längst nicht so schnell in den
Griff zu bekommen wie gedacht. Dafür versprach aber keine andere
Antriebsquelle eine so vibrationsarme Motorcharakteristik und eine so
bärenstarke Durchzugskraft wie die Erfindung des deutschen
Genie-Tüftlers Felix Wankel.
|
|
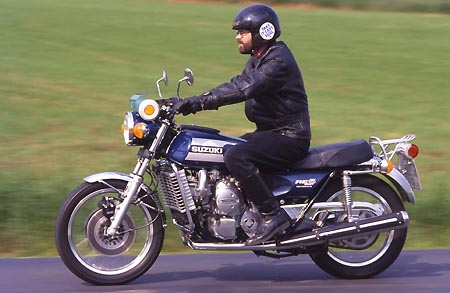
|
|
Bei Honda erstellte man
auf CB 125-Basis den Prototyp A16 mit 125 ccm Kammervolumen. Über das
Versuchsstadion kam die A16 allerdings nicht hinaus. Kawasaki nannte
1972 ihre Wankel-Studie X99. Der Zweischeibenwankel brachte 58 PS, wurde
aber wegen kaum lösbarer thermischer Probleme und einem viel zu hohen
Benzinverbrauch nicht weiterentwickelt. Ähnliches Schicksal traf die
Yamaha RZ 201, die von einem 68 PS starken Zweischeibenwankel-Motor auf
Trab gebracht werden sollte. Die 1972 bei der Tokio-Motor-Show
präsentierte zukunftsweisende Wankel-Yamaha wollte man ab 1973 vom Fließband laufen lassen. Aber auch hier waren es die immensen
Produktionsschwierigkeiten, die das Projekt unwiderruflich stoppten.
|
|

|
|
Nur bei Suzuki ließ man
sich nicht klein kriegen. Anders als bei den drei Mitbewerbern, die
längst Viertakter im Programm hatten, war Japans drittgrößter
Hersteller quer durch die Modellpalette Zweitakt-Spezialist. Und in
dieses Konzept passte ein Wankel-Motorrad haargenau hinein. Das
zunächst als RX-5 bezeichnete Wankel-Experiment sollte im
Suzuki-Programm das Flaggschiff werden.
Die Lorbeeren, das erste
Wankel-Motorrad auf die Räder gestellt zu haben, können sich die
Nippon-Konstrukteure jedoch nicht ans Revers heften. Kaum bekannt oder
vergessen ist der Wankel-Prototyp von MZ. Bereits 1963 fungierte ein
Kreiskolbenmotor, mit 175 ccm Kammervolumen und rund 25 PS Leistung, im
BK 351-Fahrgestell als rollendes Versuchslabor. Zwei Jahre später
folgte 1965 der nächste Prototyp 175L, nun aber mit fertigungstechnisch
günstigerer Luftkühlung anstelle der aufwändigen Wasserkühlung. Zu
einer Serienproduktion sollte es aber auch hier nicht kommen.
Wie ernst die
Wankel-Technik damals genommen wurde, zeigte die Tatsache, dass sich
selbst im konservativen England 1969 das BSA-Werk mit der Materie
beschäftigte. Ein Fichtel & Sachs-Stationär-Wankelmotor wurde als
Versuchsträger in die 250er BSA Starfire eingebaut. Zu kaufen gab es
dieses Bike jedoch nie. Etwas mehr Glück hatten die Norton-Fans. Ab
1971 probierte NVT (Norton-Villiers-Triumph) ein luftgekühltes
Zweischeiben-Wankelmotorrad aus. Man brachte es sogar auf den Markt und
modifizierte es später auf Wasserkühlung. Die eigentliche Sensation
waren jedoch Ende der Achtziger die Rennerfolge in der britischen
F1-Meisterschaft und 1992 der Norton Wankel-Sieg bei der TT auf der Isle
of Man.
Ebenfalls einen festen
Platz in der Geschichte fand die Hercules W 2000. Als Messe-Sensation
wurde das Hercules-Motorrad mit SACHS-Wankelmotor 1970 auf der IFMA in
Köln präsentiert. Bis der „fliegende Staubsauger" auf den Markt
kam, wurde es jedoch Frühjahr 1975. Nicht vergessen ist die Van-Veen
OCR 1000. Das mit einem Zweischeiben-Comotor-Wankeltriebwerk
ausgestattete Luxusrad darf zweifellos als Highlight in der
Wankel-Motorrad-Historie bezeichnet werden. Mehr als eine Kleinserie
sollte es von der ORC 1000 aber auch nicht geben.
|
|

|
|
Doch zurück
"ins Land der
aufgehenden Sonne" und zur Wankel-Suzuki. Genau wie andere Firmen, war
Suzuki in Hamamatsu eine von insgesamt 27 Wankel-Lizenznehmern. So wie
Honda mit der CB750 Four überzeugt war einen Meilenstein zu setzen, so
waren die Suzuki-Techniker überzeugt aus dem Wankel-Motorrad ebenfalls
einen Meilenstein zu machen. Anfang
der Siebziger begann die Entwicklung. Keinen Zweifel verschwendete man an der
Marktchance. Aus Untersuchungen war schließlich bekannt, dass die
damalige Generation junger Motorradfahrer auf jegliche technische
Neuerungen regelrecht scharf war und dass sie sich gern als
Individualisten mit ihrer Maschine von der Allgemeinheit abheben
wollten. Suzuki war sich sicher, dass die ganze Welt nur auf ein
leistungsstarkes Wankel-Motorrad wartete.
Der Aufwand wurde
allerdings immens. In kein anderes Modell investierte das Werk so hohe
Entwicklungsarbeit. Die Abdichtung des Kreiskolbens musste in den Griff
bekommen werden, dazu gab es thermische Probleme beim Motor und der
Auspuffanlage. Aber auch bei der Schmierung, der Zündanlage und dem
Vergasersystem konnten die Suzuki- Ingenieure auf keinerlei
Erfahrungswerte zurückgreifen. Alles musste neu entwickelt und
ausgiebig erprobt werden.
|
|

|
|
Für das Kühlsystem vom
Rotorblock entschied man sich für eine Kombination aus Flüssigkeits/Ölkühlung.
Gut 4,5 Liter Flüssigkeit, wovon die Hälfte aus einem speziellen
Kühlmittel und die andere Hälfte aus destilliertem Wasser bestand,
übernahmen den "äußeren" Part, für eine zusätzliche
"Innenkühlung", sowie die obligatorische Lagerschmierung vom
Kreiskolben und des Exzenters, sorgte eine Nasssumpfschmierung mit 2,2
Liter Ölhaushalt und Ölkühler. Die Dichtleisten wurden dagegen über
ein zweitakttypisches Frischölsystem geschmiert. Eine lastabhängige
Pumpe fördert das von Suzuki empfohlene spezielle RE-Öl, es konnte
aber auch handelsübliches Motoröl verwendet werden, aus dem separaten
Öltank als „Beiwerk" zum Gemisch in den Vergaser - und nebenbei
bemerkt, tröpfchenweise auch auf die Antriebskette.
|
|
Ebenfalls intensive
Kühlung benötigte die Auspuffanlage, die bei Wankeltriebwerken bis
rotglühend-heiss werden konnte. Hier waren die Suzuki Techniker auf
einen pfiffigen Einfall gekommen. Die beiden Auspufftöpfe wurden
doppelwandig ausgelegt und gleich vorne am verrippten
Leichtmetallkrümmer waren jeweils rechts und links kleine Lufteinlässe
vorgesehen. Die Schalldämpfer waren so konstruiert, dass der frische
Fahrtwind für eine Innenkühlung sorgte.
|
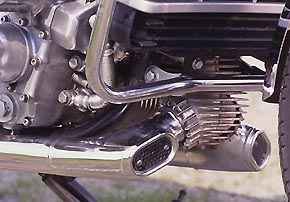 |
|
Als eine "Wissenschaft"
für sich ließen sich die Zündanlage und der Mikuni Doppelvergaser
bezeichnen. Um in den verschiedenen Betriebszuständen einen gleichmäßigen
Motorlauf hinzubekommen, kamen die japanischen Wankel-Experten auf die
geniale Idee, die Zündanlage mit zwei Unterbrecherkontakten
auszustatten. Im Teillast- und Schiebebereich zündete ein Kontakt nur
jede zweite Kammer. Kam der Motor auf Touren, schaltete ein
drehzahlabhängiges Relais gekoppelt mit einem Vakuumschalter, der vom
Unterdruck im Vergaser abhängig war, den zweiten Unterbrecherkontakt
hinzu. Jetzt wurde jede Kammer gezündet. Da normale Zündkerzen im
Wankelmotor nicht verwendet werden können, ließ Suzuki bei NGK
Spezialausführungen entwickeln. Bei gemütlicher Fahrt sollte die 9er
und bei schneller Autobahnjagd die 10er eingeschraubt werden.
Nicht minder kompliziert
ging es im Mikuni Register-Doppelvergaser zu. Der Vergaser verfügte
über einen Primär- und Sekundäreinlass. Die Drosselklappe im
Primäreinlass mit 18 mm Durchlass wurde vom Gasgriff via Bowdenzug
direkt gesteuert, während die Drosselklappe im Sekundäreinlass mit 32
mm Durchlass erst nach voller Öffnung des Primäreinlasses aufmachte.
Das war allerdings längst nicht alles. Um in allen Lebenslagen eine
optimale Gemischaufbereitung zu erreichen, war der Vergaser zusätzlich
mit Beschleunigerpumpe, membrangesteuerter Anreicherungsvorrichtung und
Absperrventil ausgestattet. Das machte ihn nicht nur außerordentlich
aufwändig, er war auch mit einer Vielzahl von Leitungen, Hebel und
Gestängen ausgestattet.
|
|
Bei der weiteren
Triebwerkskonstruktion konnte die Entwicklungsabteilung dagegen auf
bewährte Muster aus dem Motorenbau zurückgreifen. Den Primärantrieb
übernahm eine Duplexkette, eine Mehrscheibenkupplung im Ölbad leitete
den Kraftfluss ans klauengeschaltete Fünfganggetriebe weiter und den
Endantrieb erledigte eine Rollenkette. Die elektrischen Bauteile nahm
man aus dem Lager, beim Chassis bediente man sich des leicht
modifizierten Fahrwerkes der GT750, die Speichenräder erhielten
Flachschulter-Felgen aus Aluminium.
|
 |
|
Es war ein gigantisches
Werk, was Suzuki 1974 auf die Räder gestellt hatte. Die offizielle
Bezeichnung lautete nun RE 5 Rotary, wobei das RE 5 die Abkürzung für
Rotation-Engine und die 5 aufgerundet für 497 ccm-Kammervolumen stand.
Stolz konnten die Macher auf insgesamt 20 eigene Patente verweisen. Auf
dem ganzen Motorradmarkt gab es keine vergleichbare Maschine. Von einem
zierlich-sportlichen Motorrad war aber keine Rede mehr. Die RE 5 wirkte
nicht nur groß und mächtig, sie drückte auch über fünf Zentner auf
die Waage. Vieles erschien wuchtig, zum Beispiel der Tank oder der runde
Instrumenten-Kasten über dem Scheinwerfer. Neben Tacho, Drehzahlmesser,
Wasser-Thermometer, digitaler Ganganzeige gab es Kontrolllampen für
Benzin- und Ölstand, Leerlauf, Fernlicht und Blinker. Sofort hatte die
Info-Tonne ihren Spitznamen "Botanisier-Trommel" weg. In
gleicher rundlichen Aufmachung hatten die Suzuki-Designer das Rücklicht
gestylt. Nicht rund, dafür gewaltig eckig war der Wasserkühler, der
serienmäßig sogar noch von einem verchromten Sturzbügel eingerahmt
war.
|
|

|
|
Das Handling des
Wankel-Büffels war alles andere als zufriedenstellend. Durch den hohen
Schwerpunkt und den 1500 mm Radstand ließ sich jedoch nichts anderes
erwarten. Beim Rangieren und wenn`s um enge Ecken ging, zeigte sich die
Rotary wackelig, erst bei höherem Tempo glänzte sie durch sturen
Geradeauslauf. Auch in ihren Fahrleistungen riss sie niemanden vom
Hocker. Von null auf 100 km/h vergingen 6 Sekunden und das Topspeed lag
gerade mal bei 175 Sachen.
|
|

|
|
Für Tourenfahrer war sie
dagegen ideal. Ausgesprochen schaltfaul ließ sich mit ihr durch die
Gegend kutschieren. Bereits ab 2000 Touren schob das Triebwerk,
gleichmäßig ohne sich zu verschlucken und ohne lästige
Motorvibrationen, die Fuhre vorwärts. Begleitet wurde der Ausflug von
einem sonoren, zwar kräftigen, aber nicht unangenehmen,
Auspuffgeräusch.
Ganz gleich, wo die
Wankel auftauchte, sie erregte Aufmerksamkeit, die Leute blieben stehen,
fragten den Fahrer Löcher in den Bauch. Letztendlich ging es auch immer
wieder um das Aussehen. Bekanntlich lässt sich ja über Geschmack
streiten. Bei Motorrädern ist das jedoch so eine Sache, mögen oder
nicht mögen bedeutet nämlich gleichzeitig ein Verkaufsrenner oder eben
Ladenhüter. Von der anfänglichen Wankel-Begeisterung war Mitte der
Siebziger kaum noch etwas übrig geblieben. Das hatte allerdings wenig
mit der Optik zu tun, als vielmehr mit dem Ruf. Nicht immer waren es die
Dichtleisten vom Rotor, die kaputt gingen, stand eine Wankel erst einmal
in der Werkstatt, war natürlich gleich der Motor hin. Basta! Das
eigentliche Problem der RE 5 Modell M war aber die Zündanlage und der
Vergaser. Und diese Schäden ließen sich nur von Spezialisten
reparieren. Suzuki hatte zum Glück an alles gedacht. Es gab
ausführliche Betriebsanleitungen und Reparaturhandbücher, Lehrgänge,
eine Fülle von Spezialwerkzeug sowie spezielle Prüf- und Messgeräte.
Wer mitreden wollte, musste sich in die Materie einarbeiten. Und das war
bereits das erste Problem. Von den RE 5-Besitzern war dies nicht zu
verlangen, schließlich konnte man ihnen die Werkstattausrüstung ja
nicht gleich mitverkaufen und die jungen Suzuki-Werkstätten hatten
weiß Gott andere Probleme. Ohne im Nachhinein die Qualitäten der
damaligen Mechaniker und Werkstattmeister abzuwerten, viele waren mit
der Wankel-Technik schlicht überfordert. Auch fehlte die Erfahrung,
aber woher sollte sie auch kommen. Lediglich 65 Suzuki RE 5 Rotary
wurden nach Deutschland importiert. Suzukis Traum vom Topseller wurde
zum Alptraum. Von der ersten Stunde an war die Wankel ein Exote.
|
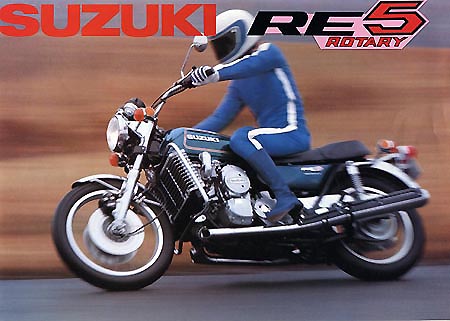
Suzuki RE5 Rotary Modell A
(Foto:
Werk) |
Daran
änderte auch das Nachfolgemodell RE 5 Rotary Modell A nichts.
Rundinstrumente, kontaktlose Zündung und modifizierter Vergaser
brachten zwar optische und technische Verbesserungen, haben wollte die
Wankel inzwischen aber schon lange keiner mehr. Ein enthusiastisches,
aber auch kostspieliges Experiment war für Suzuki damit beendet.
|
Technische Daten
Suzuki
RE 5 Rotary Modell M
Baujahr 1975
|
Motor:
Flüssigkeits/ölgekühlter
Dreikammer-Einscheiben-Kreiskolbenmotor (Lizenz NSU-Wankel), Kammervolumen 497 ccm,
Verdichtung 8,6:1, 62,8 PS bei
6500/min, ein Mikuni
Register-Doppelvergaser, 18-32 HHD, Kondensator-Zündanlage mit zwei Unterbrecherkontakten,
Schmierung Nasssumpfschmierung
mit 2,2 Liter Ölhaushalt und Verlustschmierung über lastabhängige
Ölpumpe aus separatem Öltank mit 4-Takt-Öl, Lichtmaschine 12
Volt/ 280 Watt
Antrieb:
Primärantrieb
über Duplexkette, Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe,
Endantrieb über Kette
Fahrwerk:
Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, Telegabel, Hinterradschwinge mit zwei
Federbeinen, vorn
Doppelscheibenbremse und hinten Trommelbremse, Bereifung vorn 3.25H19,
hinten 4.00H18, Gewicht 260 kg
Spitze: 175 km/h
Preis: 8890 Mark
|