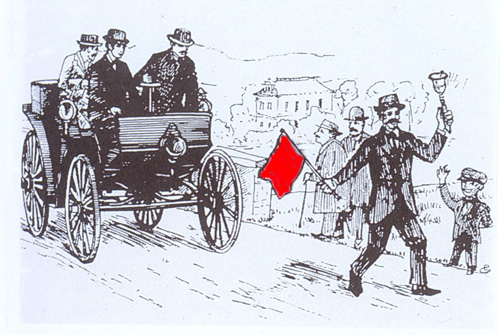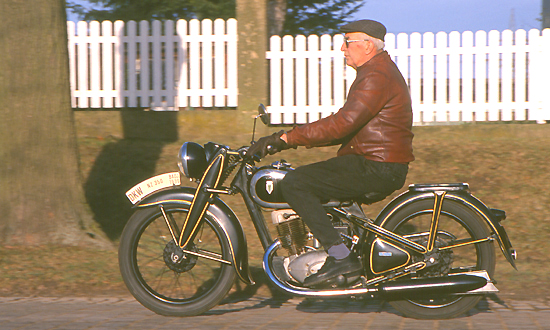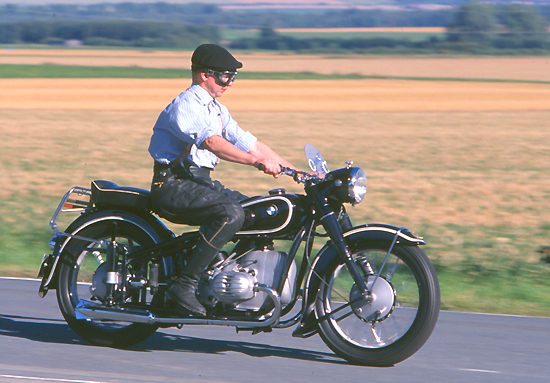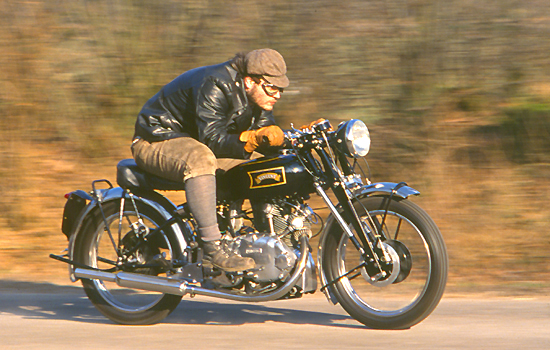|
Lexikon
|
|
Motorradbekleidung von Kopf bis Fuß im Wandel
der Zeit
Kleider machen Leute
Motorradbekleidung hat verschiedene
Aufgaben. Sie soll mollig
warm halten, vor unansehnlichem Straßenschmutz und bei Regen
vor Nässe schützen. Im Falle eines Abfluges schmerzliche Blessuren
möglichst vermeiden und dazu auch noch schick aussehen.
Text: Winni Scheibe
Fotos: Scheibe, Werk, Archiv |
|

|
|
Als um 1900 sich die Erfindungen von Autos und Motorrädern
immer häufiger im Straßenbild blicken ließen,
war die Aufregung zunächst recht groß. Dass diese neumodernen Fahrzeuge
gewaltige Risiken für Leib und Leben bedeuteten, erkannten Behörden
ziemlich schnell. In England war es zum Beispiel in dieser Zeit zunächst
per Gesetz vorgeschrieben, dass den gefährlichen zwei- und vierrädrigen
Vehikeln eine Person mit einer warnenden Fahne vorweg schreiten (!)
musste. Diese Vorsichtsmaßnahme galt allerdings nicht den motorisierten
Aktivisten, sondern der Bevölkerung. Auf keinen Fall durfte den
neugierig herbei laufenden und gaffenden Menschen etwas passieren.
|
|
|
|
Mit Schal, Bommelmütze und wetterfester Kleidung
Typische Motorradbekleidung bis weit in die
1930er Jahre
|
|

Sportfahrer auf einer DKW ZSW500 von
1928 |
|

Gespannfahrer - Zündapp KS800 von 1933
|
|
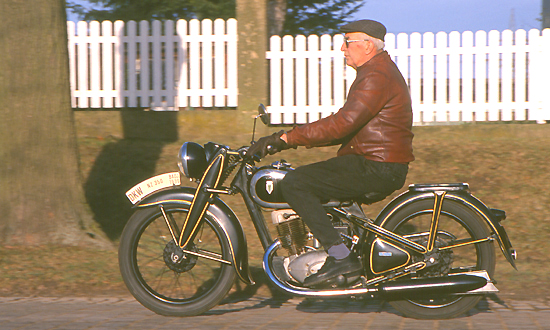
Zweitakt-Nobelkradler - DKW NZ350 von 1939
|
|

Vive la France Dampfhammer Reiter -
New-Map 350 BYS von 1931
|
|
An einen speziellen Schutz der Kraftradfahrer
dachte indes (noch) niemand. Wem es bei rasanter Fahrt auf dem
Feuerstuhl um die Ohren oder
an der Stirn zu kalt wurde, der wickelte sich einen dicken Schal um und
setzte eine Bommelmütze auf. Die restlichen Körperteile hüllte man in
warme und möglichst wetterfeste Kleidung, die Füße steckten in solidem
Schuhwerk.
Um aber aller Welt zu zeigen, wie flott die Benzinkisten wirklich waren,
veranstaltete man Rennen. Eng anliegende Lederjacke und Lederhose, hohe
Stiefel, Handschuhe, eine fesche Lederhaube und eine Schutzbrille
gehörten zunächst zum zeitgemäßen Outfit der Vollgaspiloten. Auf die
Idee, diese Fahrerausstattung als spezielle Motorradbekleidung zu
bezeichnen, wäre damals kein Mensch gekommen. Je nach Bedarf wurde diese
"Allzweck"- Bekleidung nämlich auch bei schlechtem Wetter, im Winter,
auf der Jagd oder beim Angeln, beim Reiten oder im offenen Automobil
getragen. Auch auf den Gedanken, beim Motorradfahren einen "Sturzhelm"
aufzusetzen, kam man erst etliche Jahre später. In der motorisierten
Frühgeschichte gab es noch keine geeigneten Sturz- oder Schutzhelme.
|
|
Fliegerhelme für die Kradler
|
|

"Hut-Mode" in den 1920er -1930er Jahren
“Döberitz-Helm“ |
|
Den Bedarf
erkannte man jedoch recht bald. Zweck entfremdend stülpten sich die
Rennfahrer einen Fliegerhelm aufs Haupt. Diese robusten Lederhauben
hielten nicht nur mollig warm, sondern minderten bei einer "Notlandung"
auf der Piste oder im Straßengraben tatsächlich Kopfverletzungen. Bei
einigen Helmen bestand die Halbschale aus dickem Leder, die, wie zum
Beispiel beim "Döberitz-Helm", zusätzlich mit einer über Kreuz
aufgenähten "Lederwurst" verstärkt wurde. Der Kopf selbst steckte
allerdings nicht direkt in der Lederschale. Für eine zusätzliche "Stoßdämpfung" war der Innenraum ausgefüttert oder bei besseren
Ausführungen sogar mit einem Kreuzband ausgestattet. Schneidereien
hatten sich inzwischen auch auf die Sonderwünsche der verwegenen
Zweiradpiloten eingerichtet und fertigten auf Wunsch feste Lederjacken
und -hosen.
|
|

DKW-Firmenprospekt von 1936
|
|
Das gewöhnliche Volk auf der
Landstraße war erheblich anspruchsloser. Entweder fuhr der Kradler ganz
"oben ohne", oder er stülpte sich eine Wollmütze oder Schirmkappe über.
Wollte man die Maschine mal voll ausfahren, wurde die Mütze mit der
Schirmseite einfach nach hinten gedreht. So war die Kopfbedeckung
spielend "80-Sachen-fest"! Besser gestellte Kraftradfahrer trugen weiße
Leinen- oder schicke Lederhauben. Ernsthafte Konkurrenz bekamen die
“elastischen“ Kopfbedeckungen erst viel später.
Für die restlichen Körperteile vertraute die Zweiradzunft auf
alltagsübliche Straßenbekleidung, bestehend aus fester Jacke, Stoffhose
und einfachen Schuhen. Handschuhe dagegen trugen meist nur feinen
Herrschaften.
Was allerdings
nicht heißen soll, man hätte sich nicht schon damals Gedanken gemacht.
Wind-, wetter- und regendichte Mäntel kamen bald als "Schutzkleidung"
schwer in Mode.
|
|
Motorradbekleidung aus Wachscotton
|
|

Zeitlos: Wachscotten-Motorradjacke, stilch
und echter Biker auf einer englischen BSA |
|
Etwas größeren Einfallsreichtum bewiesen die Engländer. Die königlichen
Seefahrer hatten nämlich schon viel früher als die Biker das Problem mit
ständig schlechtem Wetter. Ihre pitschnassen Sachen wurden über Wochen
nicht trocken, zum Glück wussten sie sich zu helfen. Aus Segeltuchresten
nähten sie sich Jacken und Mäntel, die die cleveren Matrosen mit einer
selbst gebrauten Mixtur aus Teer und Tran tränkten. Ihre Hochseemode war
nicht nur wasserdicht, die Klamotten hielten auch noch warm. Diese Wind-
und Wetterkleidung gilt als Vorbild der späteren Wachscotton-Motorradfahrerbekleidung.
Auf die Geschäftsidee so etwas ähnliches auch für Landratten anzubieten
kam Harry Grosberg Anno 1924. Seine Baumwoll-Bekleidung imprägnierte der
Pfiffikus mit einer Wachsschicht und nannte sie "Belstaff". Die
schwarzen "Teerjacken" waren nicht nur wind- und wasserdicht, sondern
auch atmungsaktiv und verfügten über einen passablen Tragekomfort. Es
dauerte nicht lange und Motorradfahrer, die britische Armee und sogar
Flieger schworen auf Wachscotton-Bekleidung von Belstaff.
Konkurrenz bekam Belstaff Mitte der 1930er
Jahre von Barbour. John Barbour, schon seit 1894 Experte für die
Herstellung von gewachster Baumwoll-Bekleidung für Seeleute und
Hafenarbeiter, hatte sein Angebot für die Motorradkundschaft erweitert.
Belstaff oder Barbour, Barbour oder Belstaff, unter den Motorradfahrern
wurde die Marke zum Glaubenskampf. Wirtschaftlich hatte Barbour die Nase
vorne, bis in die 1960er Jahre sollte der Ausstatter Marktführer
bleiben.
Alois Drax aus München brachte Mitte der 1930er Jahre einen für
jedermann käuflichen Motorradfahrer-Schutzhelm in einer Hartschale-Form
auf den Markt. Gut 20 Jahre war für die sportbegeisterten Motorradfahrer
die "Drax-Halbschale" das Maß der Dinge. Tauchte irgendwo ein
Sportsfreund mit solch einem "Sturzhelm" auf dem Kopf auf, wurde er von
seinen Artgenossen jedoch mitleidig belächelt und sogar als Spinner oder
Angeber links liegen gelassen. Mit diesen "Rennfahrern" wollten die
erfahrenen Windgesichter nichts zu tun haben.
Mit der
Aufstellung von Motorrad-Kompanien bei der Wehrmacht in den 1930er
Jahren wurden auch Krad-Mäntel in Dienst gestellt. Klepper lieferte
gummierte Leinenmäntel, die um die Beine umgeschlagen und zugeknöpft
werden konnten. Bis 1945 wurden von den Krad-Meldern Stahlhelme und
Staubschutz-Brillen getragen.
|
|
Bunt zusammengewürfelte
Motorradbekleidung, die
bevorzugten Farben
waren schwarz oder grau und weiß bei den Helmen
Kradfahrer-Mode in den 1950er Jahren
|
|

Horex Regina Fahrer |
|
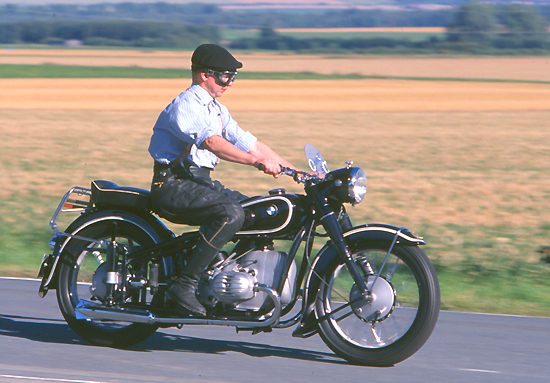
"King of the Road": BMW R51/3 Fahrer
|
|
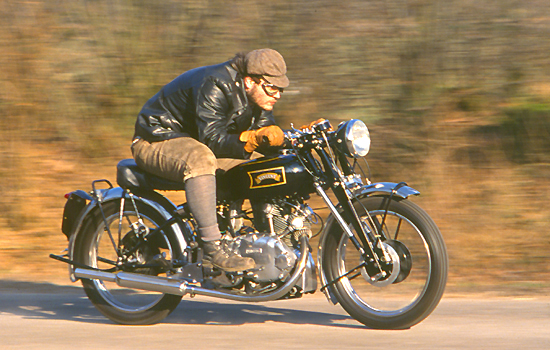
Vincent 500 Comet Fahrer
|
|
In den 1950er Jahren war
West-Deutschland weltgrößter Motorradhersteller. In dieser Blütezeit
waren über 2,2 Millionen Maschinen zugelassen. Gut 40 Firmen bauten leichte
Zweitakt-Maschinen mit 98, 125, 150, 200 oder 250 ccm Hubraum und
maximal 10 PS Leistung. Diese bis 90 km/h schnellen Maschinen wurden als
"Brot und Butter" - oder "Westerwald-Motorräder" bezeichnet. Sie waren
günstig in Anschaffung, Unterhalt und Wartung. An die Technik wurde kaum
Ansprüche gestellt. Wichtig war nur, sie musste simpel sein und
funktionieren. Streikte sie doch einmal, konnte sich der Fahrer in den
meisten Fällen selbst weiter helfen und reparierte den Schaden gleich am
Straßenrand.
Große Sprünge konnte man
sich damals noch nicht erlauben. Wer mobil sein musste oder wollte,
durfte froh sein, wenn er sich überhaupt so einen knatternden und
stinkenden Feuerstuhl oder einen Roller leisten konnte. Große
Viertakt-Maschinen waren die Ausnahme und ließen sich an einer Hand
abzählen. Von Horex gab es die 350er Regina, von NSU die 500er Konsul,
von BMW die 250er R25/2, die 500er R51/2 und die 600er R67 und von
Zündapp die 600er KS601. Jeder, der Mitte der 1950er Jahre so eine
Maschine ohne oder mit Beiwagen besaß, war "King of the Road".
|
|
Hinsichtlich der Fahrerbekleidung gab man
sich zunächst ebenfalls bescheiden. Die breite Masse saß in ihren
gewöhnlichen Straßensachen auf dem Roller, der Maschine oder dem
Gespann. Besonders am Sonntag oder an Feiertagen. Wenn es in die Kirche,
zu Verwandten oder einer Verabredung mit der neuen Freundin ging, da
wollte man einfach schick aussehen und nicht gleich als Motorradfahrer
erkannt werden. Für den Fall der Fälle wurde auf dem Gepäckträger ein
Motorradmantel festgeklemmt. Diese günstigen und praktischen Kradmäntel
waren speziell auf die Bedürfnisse der Motorradfahrer ausgerichtet. Das
Baumwollgewebe hatte außen und innen eine Gummibeschichtung und war
somit wind- und wasserdicht. Die Oberfläche ließ sich nach einer
Regenfahrt oder nach verschmutzen Streckenabschnitten einfach reinigen.
Diese Krad- oder Fahrmäntel waren weit geschnitten, so dass man sie
bequem über die normale Bekleidung ziehen konnte. Beliebt unter den Kradlern waren die Fahrmäntel von Klepper und Marquardt.
|
|
|
|

Triumph-Prospekt von 1956
|
|
Die etwas besser
gestellte Fraktion vertraute auf die englische Wachscotton Bekleidung
von Barbour oder Belstaff. Überzeugte Motorradfahrer, die es sich
leisten konnten, trugen dagegen Lederbekleidung. Aber ganz gleich, in
was sich damals der Kradler hüllte, bei der Kopfbedeckung herrschte
weitgehend Einigkeit und die lautete "oben ohne". Oder anders gesagt,
Motorradhelme waren einfach noch nicht in Mode. Wie eh und je trugen die
Helden der Landstraße eine Schiebermütze oder Lederkappe.
|
|
Eine Eierschale aus
Pappmache
|
|

Gegen Wind und Wetter:
"Eierschale und Lederjacke" |
|

Gehobener Standard:
Schuberth-Halbschalenhelm von 1955
|
|

Römer-Halbschalenhelm von 1960
|
|
Erste "echte" Motorrad-Halbschalenhelme gab
es bei uns Anfang der 1950er Jahre. Augenfälliger Unterschied zur
Lederkappe war die glatte und feste Außenschale. Sie bestand aus einem
verklebten oder harzverstärkten Leinen- oder Papiermaterial. Im
Volksmund auch als Pappmaché bezeichnet. Diese "Eierschale" sollte das
Durchdringen fester Gegenstände verhindern. Für die eigentliche
Stoßdämpfung war je nach Helmtyp der Innenbereich mit einer dünnen Lage
aus Kork oder Filz ausgeschlagen und zusätzlich mit einem Kreuzband aus
stabilem Baumwollgewebe versehen. Den Kopf nahm die "Wiege", eine nach
oben offene Baumwollmütze auf. Je nach Kopfgröße ließ sich die
Passgenauigkeit über eine Schnürung verstellen. Ein Nackenschutz und
Kinnriemen aus Leder sicherten den guten Halt auf dem Kopf. Viel
Sicherheit hatte die "Knalltüte" allerdings noch nicht zu bieten. Erlitt
der Akteur Bodenkontakt und schlug mit dem Helm hart auf die Fahrbahn
auf oder prallte mit ihm gegen ein Hindernis, konnte es durchaus
passieren, dass die Außenschale wie Glas zerbrach.
Ungeachtet dieses Mankos wurde im
Straßenrennsport, im Speedway und bei den Sandbahnrennen die
"Helmpflicht" eingeführt. Bei Zuverlässigkeitsfahrten, Gelände- oder
Trialveranstaltungen begnügte man sich weiterhin mit den Woll- oder
Lederkappen.
|
|
Die Helmlegende: "Cromwell"
|
|

Jim Redman, Honda-Werksfahrer
und sechsfacher Weltmeister
(Foto: Archiv-Redman) |
|
Bald kam das "Helmtragen" in Mode. Dieser
Trend aus England hieß Cromwell. Die feste Außenschale des
Cromwell-Halbschalenhelms war aus "Vulkan-Fiber" gefertigt. Im Vergleich
mit früheren Mustern war die Außenschale längst nicht mehr so
bruchgefährdet. Die Innenausstattung orientierte sich an bekannten
Ausführungen. Anfang der 50er Jahre gab es erstmalig die
Cromwell-Halbschale aus duroplastischem Kunststoff, in diesem Fall aus
GfK (Glasfaser verstärktes Polyesterharz). Das Außenmaterial bestand aus
mehreren Schichten Glasfasergewebematten, die mit Kunstharz getränkt
waren. Die GfK-Schale wurde handlaminiert und zeigte hervorragende
Eigenschaften. Sie war außergewöhnlich stabil, unempfindlich gegen
Witterungseinflüsse und Lösungsmittel, ließ sich individuell lackieren
und nach Lust und Laune mit Aufklebern dekorieren.
|
|

Sportfahrer Outfit Ende der 1960 - Anfang
der 1970er Jahre
|
|
Trotz des
immensen Sicherheitsgewinnes teilte sich die Zweiradzunft auch weiterhin
in zwei Lager. Die einen lehnten kategorisch das Tragen eines
Schutzhelms ab. Andere hatten Rennfahrer als Vorbilder. Genau wie Mike Hailwood, Giacomo Agostini, Jim Redman oder Phil Read, um hier nur vier
mehrfache Weltmeister zu nennen, steckten sie ihre Birne in den
englischen Hut. Als Augenschutz bevorzugte man Brillen von Fospaic,
Monza oder Climax und als Zeichen der Kameradschaft trug man den "gelben
Schal". Ob im Rennsport oder Straßenverkehr, der Cromwell war bald nicht
mehr wegzudenken. Manche Motorradfahrer bevorzugen noch heute die
klassische Schüssel.
|
|
Die Neuzeit
Ab der 1970er Jahre
|
|

Kawasaki Z900 "Z1" von 1973
Motorrad-Testlegende Franz Josef Schermer, "FJS", noch im damaligen
Zeitgeist mit
Cromwell-Helm, Lederkombi (ohne Protektoren), Stiefel und Handschuhen |
|
Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre
änderte sich das Bild der Motorradfahrer grundlegend. Ein regelrechter
Boom kam in die Gänge. Junge Leute hatten das Motorrad für Spaß, Sport
und Freizeit entdeckt. Zu der richtigen Maschine gehörte auch die
entsprechende Fahrerausrüstung. Und die reichte von Kopf bis Fuß. Cromwell-Helme trugen nur noch die
"Windgesichter", bei allen anderen
war der Jet-Helm angesagt oder ein "Marshelm". So wurden zunächst etwas
spöttisch diese modernen Integral-Helme bezeichnet. Zur Norm gehörte
dagegen die ein- oder zweiteilige Lederkombi von Harro oder Erbo. Dazu
echte Motorradstiefel und Motorradhandschuhe. Von Hein Gericke gab es
Regenkombis.
|
|

Kawasaki GPZ900R von 1983
|
|
In den
nächsten Jahren ging es dann Schlag auf Schlag. Der Integral-Helm setzte
sich durch. Lederkombis wurden immer bunter und eingearbeitete
Sturz-Protektoren immer ausgefeilter. Die Wachscotton-Mode wurden von
Textil-Fahreranzügen abgelöst, die heute neben den Lederkombis zum Maß
der Dinge zählen.
|
|
|
|
Glaubenssache:
Lederkombi oder Textilanzug

|
|
"Recht&Pflicht"
|
|

Ab dem 1. Januar 1976 war es
mit "oben ohne" vorbei!
 |
|
Mit der Freiheit "oben ohne" war es am 1. Januar 1976 vorbei. Für Benutzer von
Kleinkrafträdern, Krafträdern und Rollern wurde die Helmtragepflicht
eingeführt. Ab Mitte 1978 mussten auch die Mokick- und Mopedfahrer
einen Schutzhelm tragen. Verstöße gegen diese Auflage wurden aber
(noch) nicht bestraft, erst ab dem 1. August 1980. Wer ohne Helm auf
dem Kopf erwischt wurde, bezahlte 30 Mark (ab 1.1.2002 15 Euro)
Bußgeld. An diesem Betrag hat sich bis heute nichts geändert. Damit
alle motorisierten Zweiradfahrer vor dem Gesetz gleich sind,
erweiterte man am 1.10.1985 die Helmtragepflicht auch auf die
Mofafahrer.
Der nächste Streich war die Normung. Ab
Oktober 1988 trat nämlich die neue Helmnorm ECE R-22 in Kraft. Eine
knüppelharte Prüfnorm, die nur noch moderne Integral- und hochwertige
Jet-Helme schafften. Der Aufschrei in der Szene war groß. Damit nun
nicht jeder gleich einen neuen ECE-geprüften Helm kaufen musste,
gewährte der Gesetzgeber bis Ende 1990 eine Übergangsfrist. Die Wogen
glätteten sich wieder. Wer bis zu dieser Zeit mit einem Cromwell auf dem
Kopf erwischt wurde, kam mit einer Verwarnung davon. Für alle alten
Schüsseln galt nämlich weiterhin die DIN 4848, die "Helmtragepflicht"
war damit erfüllt.
Ab 1990 löste
die ECE 22-02 und ab 1992 die ECE 22-03 die ursprüngliche ECE-Norm von
1988 ab. Aber auch die ECE 22-03 ist längst überholt. Nach der ECE 22-04
kam die ECE 22-05...
Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) wurde zum
1. Januar 2006 überarbeitet. Aus der Bezeichnung "amtlich genehmigter
Schutzhelm" wurde "geeigneter Schutzhelm". Mit der Überarbeitung wurde
die Ausnahmeverordnung, in der die unbefristete Verwendung von Helmen,
die nicht in amtlicher genehmigter Bauart ausgeführt sind, aufgehoben.
Nach diesen vielen verwirrenden Normeinteilungen fragt sich der
verunsicherte Klassiker- und Oldtimer-Liebhaber sicherlich zu Recht:
darf er jetzt überhaupt noch einen klassischen Halb tragen? Die Antwort
kann nur lauten: Eigentlich NEIN!
|
|

"Born to be wild" |
Damit wäre das Thema
eigentlich erledigt. Bleibt zum Schluss lediglich nur noch die Frage:
was passiert nach einem Crash. Und hier steht ein großes Fragezeichen.
Wenn's an "Zahlemann & Söhne" geht, können Assekuranzen gewaltig
kleinlich werden. Lässt sich dem Geschädigten nämlich nachweisen, dass
seine Kopfverletzungen auf Grund eines alten oder eines unzureichenden
oder nicht "geeigneten Schutzhelms" zurückzuführen sind, kann man ihm
eine Mitschuld anrechnen. Bei Schmerzensgeldforderungen oder
Ersatzansprüchen kann es ähnlich aussehen. Vielfach landen Streitereien
vor Gericht. Eine Mitverschuldungshaftung ist juristisch möglich und
auch zulässig. Hätte das Unfallopfer nämlich einen modernen Integralhelm
getragen, so vielfach die Auffassung der Richter, wäre längst nicht so
viel passiert.
|
|
Text-Archiv:
Lexikon
|