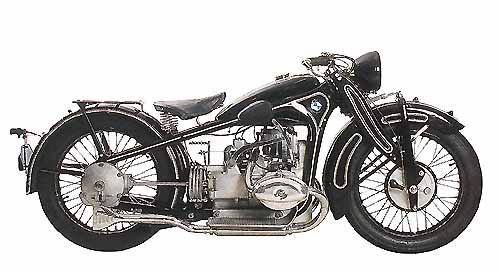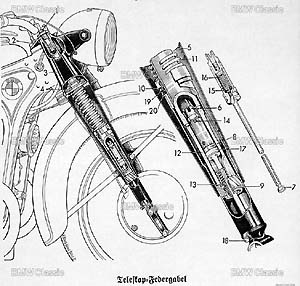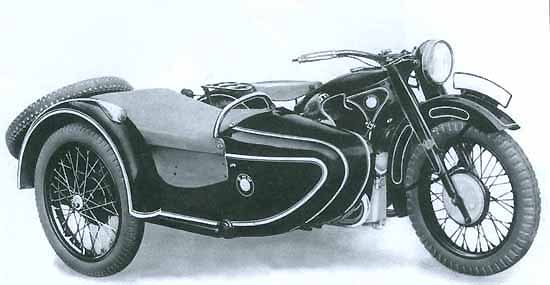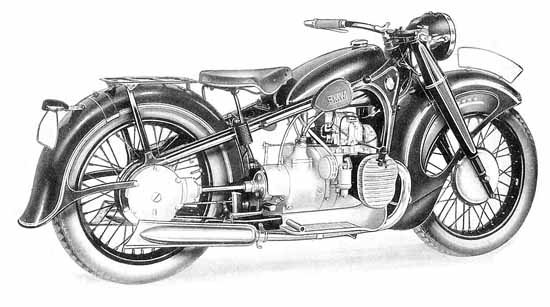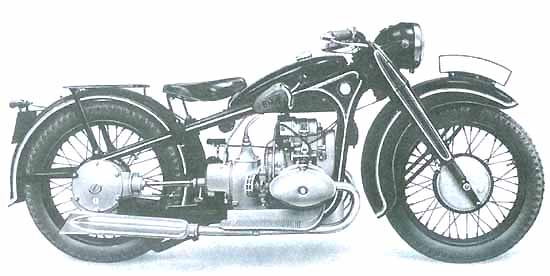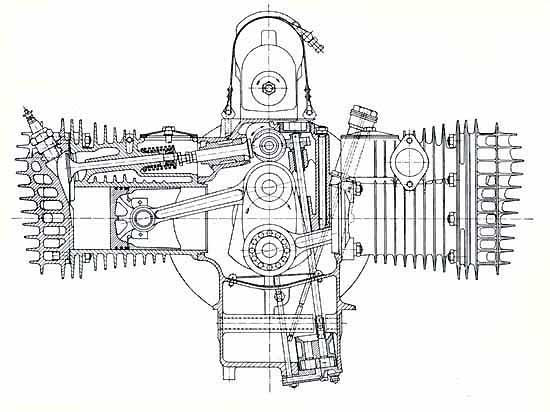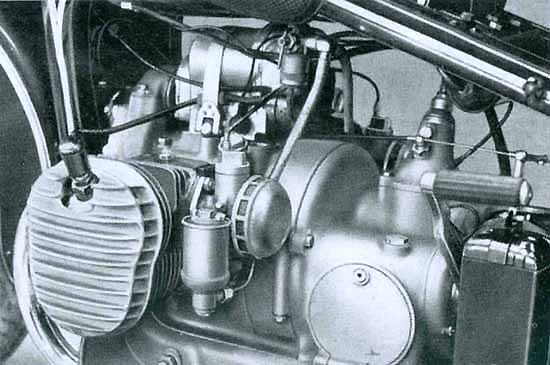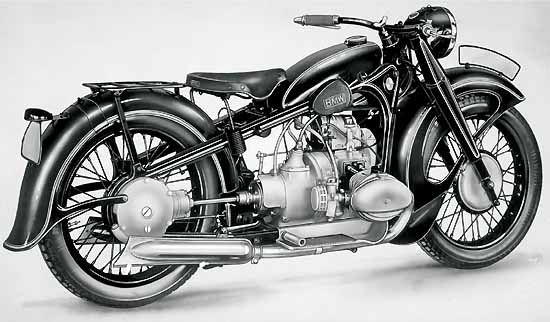|
BMW
Motorräder genießen einen hervorragenden Ruf. Sie sind zuverlässig,
langlebig, robust, wartungsfreundlich und wertbeständig. In England und
den USA bezeichnet man sie gerne als "King of the Road". Es gibt
allerdings auch eine Kehrseite. Und das ist das biedere und konservative
Erscheinungsbild. Fast möchte man behaupten, es gehört zu den
BMW-Maschinen wie ein Brezel zur Weißwurst. Dies änderte sich erst in der
letzten Zeit, seit eine Reihe von neuen Modellen mit Einzylinder oder Twin,
mit Reihenvierzylinder oder topaktuell mit Sechszylinder-Motor auf den
Markt kam. Auch der Kardan ist längst nicht mehr obligatorisch. Als
Endantrieb darf inzwischen ein Zahnriemen oder eine Kette dienen. Doch das
ist ein andere Geschichte. |
|

BMW K1600GT von 2011
|
|

BMW R32 von 1923
(2 Fotos: BMW)
|
|
Die
Mixtur aus Qualität und Tradition macht eine BMW zu dem, was sie ist: Ein
guter Kamerad, auf den man sich verlassen kann. BMW-Fahrer sind stolz auf
ihre Maschinen, nichts lassen sie auf ihre Marke kommen. Und dass es auch
so bleibt, dafür sorgten die BMW Ingenieure im Münchener Stammwerk - heute
wie gestern. Schon die erste BMW R32, Anno 1923, verfügte über einen 500er
Boxermotor und Kardanantrieb. Dieses Bauprinzip verschaffte BMW Weltruf,
sollte BMW-typisch werden und gehört, selbstverständlich immer
weiterentwickelt, bis heute zum "BMW-Markenimage".
|
|
|
|
BMW R16 von 1930
(Foto: BMW) |
|
Insgesamt
lief es für BMW Anfang der 1930er Jahre allerdings nicht besonders rosig.
Mitarbeiter wurden entlassen, keiner wusste, wie es weitergeht. Doch schon
bald sollte sich die Situation ändern. Von 1933 auf 1934 brachte eine rege
Nachfrage dem Werk neue Aufträge. Recht bald konnte man wieder Leute
einstellen, die Belegschaft in den Werken München und Eisenach wuchs auf
4300 Arbeiter und Angestellte.
Kaum zehn Jahre im Geschäft teilte sich BMW bereits Mitte der 1930er Jahre
mit Zündapp den Markt für die hubraumstarken Maschinen in Deutschland.
Flaggschiffe im damaligen BMW-Programm waren die R11 mit 750er sv-Motor
und die R16 mit 750er ohv-Triebwerk. Beide Boxer-Modelle verfügten über
identische Fahrwerke. Bei der Ausführung des Doppelschleifenrahmens
vertraute BMW auf die damals übliche Pressstahlfertigung, die
Hinterradführung war starr. Wollte der Maschinist das Hinterrad abbremsen,
hob er den rechten Fuß vom Trittbrett und stieg mit der Ferse auf den
Hebel zur Betätigung der Kardanbremse. Die Führung des Vorderrads übernahm
eine Blattfeder-Schwinggabel, eine Halbnaben-Trommelbremse sorgte für
zeitgemäße Verzögerung.
Sich zurücklehnen und auf den Lorbeeren ausruhen, kam für die Münchner
allerdings nicht in Frage. Im Versuch lief schon die nächste
Boxer-Generation.
|
|
Anfang der 1930er Jahre
steckte die Fahrwerkstechnik
noch in den Kinderschuhen
|
|

BMW R10 von 1932
Pressstahlrahmen mit Blattfeder-Schwinggabel und starrer Hinterradführung |
|
Für
die Erprobung neu entwickelter Bauteile nutzte auch BMW den Motorsport. Im
knüppelharten Wettbewerb zeigte sich, welche Konstruktion etwas taugte
oder auch nicht. Das war allerdings auch nötig. Mit einer vollkommen neuen
Teleskop-Federgabel wollte der bayerische Motorradhersteller die
Fahrwerkstechnik revolutionieren. Zur Ehrenrettung von SCOTT sei jedoch
angemerkt, dass die englische Manufaktur bereits 1909 mit einer Telegabel
experimentiert hatte, durchsetzen konnte sich diese Vorderradführung
damals allerdings noch nicht. War die bisher in den BMW Modellen
verwendete Blattfeder-Schwinggabel im Prinzip ein stabiles und robustes
Bauteil, blieben die Nachteile jedoch unübersehbar. Die Ausführung bot nur
wenig Federweg und keine Dämpfung.
|
Ganz
anders die neue Telegabel. In den Gabelbrücken klemmten die
Standrohre, unten lugten die Tauchrohre heraus, an denen die
Achshalter für das Vorderrad befestigt waren. Innerhalb des Bauteiles
hatten die Druckfedern und eine hydraulische Öldämpfung ihren Platz.
Die große Herausforderung bestand in
der passgenauen Fertigungstechnik. Die Tauchrohre mussten leichtgängig
in den Standrohren rein- und rausgleiten können und der Ölvorrat für
die hydraulische Dämpfung musste über eine dauerhafte Abdichtung
verfügen. Im Fahrbetrieb übermittelte die Telegabel einen bisher nicht
gekannten Komfort. Gegenüber der bekannten Blattfeder-Schwinggabel
konnte sie für damalige Verhältnisse beachtliche 80 Millimeter
Federweg vorweisen. Feinfühlig rollte das Vorderrad über die Chaussee.
Auch bei Kurvenfahrt lag die BMW nun deutlich sicherer auf der Straße.
Nach dem Eintauchen dämpfte das hydraulische System das schnelle
Ausfedern. Das bei der reinen Federgabel unangenehme Nachschwingen war
nun Schnee von gestern. |
|
|
|
Die
Telegabel fand ihren festen Platz in der Fahrwerkstechnik. Heute ist diese
Vorderradführung nicht mehr wegzudenken, doch darauf musste vor gut 80
Jahren erst einmal jemand kommen. Bis die neue Gabel jedoch in die
Serienfertigung einfloss, wurde sie bei allen möglichen
Rennveranstaltungen, bei Langstreckenfahrten und bei Geländewettbewerben
ausgiebig getestet. |
|
Ab 1935 hatten die BMW R12 und BMW R17
weltweit als erste Motorräder eine Telegabel
|
|
|
|
BMW R12 wahlweise Solo oder
als Gespann
|
|
|
|
BMW R12
Zwei-Vergaser-Modell
|
|
|
|
BMW R17
(3 Fotos: BMW) |
|
Für
das Modelljahr 1935 präsentierte BMW die neue R12 und R17 mit Telegabel.
Beide 750er Modelle waren die logische Weiterentwicklung der
Vorgängermodelle R11 und R16. Neben der Telegabel gab es eine Reihe
weiterer beachtenswerter Modifikationen. Die Vorderradbremse war nun so
ausgeführt, dass der Bremshebel in der Bremstrommel lag und so gegen
Verschmutzung oder äußere Beschädigung kaum noch einer Störung unterlag.
Bei der Chassis-Ausführung blieb es bei der bewährten Pressstahlfertigung.
Auch war man in der damaligen Motorradwelt der Meinung, dass ein
gefedertes Hinterrad längst nicht automatisch zu einer Verbesserung der
Straßenlage führen würde. Also drehte sich das Hinterrad weiterhin ohne
einen Millimeter Federweg im Heck. Wirkte bei den Vorgängermodellen der
Hinterradstopper noch auf die Kardanwelle, war nun im Speichenrad eine
Trommelbremse verbaut.
|
|

|
|
Zur Pflicht gehörte damals, dass
an das Krad ein Beiwagen angeschlossen werden konnte. Alle drei 3.50x19
Räder waren untereinander austauschbar. Und für den Fall des Falles, dass
ein Plattfuß dem Ausflug ein jähes Ende bereitete, thronte hinten auf dem
Beiwagen ein Reserverad. Nicht nur Plattfüße, auch Pannen gehörten zum
Alltag, entsprechend gut war das Bordwerkzeug sortiert. Das Werkzeugfach
befand sich links im Getriebegehäuse. An kalten Wintertagen eine angenehme
Sache, die Schraubenschlüssel hatten eine angenehme Handwärme. Neu war
weiterhin das klauengeschaltete Vierganggetriebe, der Schalthebel lag nun
rechts im Kniekissen am Kraftstofftank.
|
|

Werkzeugfach im Getriebegehäuse |

Viergang-Schaltung |
|
|
Den horizontal geteilten 750er Boxer-Motor gab es in Ein- und
Zweivergaser-Version. Für die einfache Ausführung mit SUM-Drei-Düsen-Vergaser war eine raffinierte
"Vorwärmung" installiert. Von
den Auspuffkrümmern führten zwei Heizleitungen bis zum Vergaser. Durch die
baulich bedingten langen Ansaugkanäle wollte man mit diesem Trick das
Abtropfen des Kraftstoff-Luftgemisches im Ansaugtrakt verhindern sowie
vorsorglich ein Vergaser-Vereisen im Winter vermeiden. Die "Heizung" lief
allerdings ständig. Nachteilig war es nicht, das 18 PS starke Kraftpaket
surrte im Winter wie im Sommer wie ein Uhrwerk. Gut zwei PS mehr
Motorleistung hatte die R12 mit zwei Amal-Vergasern.
|
|
|
|

BMW R12-Triebwerk mit einem Vergaser und
"Heizrohren" |
|
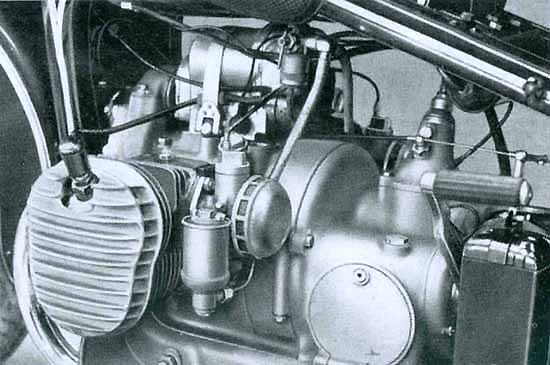
BMW R12-Triebwerk mit Vergasern)
|
|
Mit der neuen Telegabel, den weit
nach unten geschwungenen Schutzblechen, sowie den massiven Trittbrettern
aus Alu-Guss wirkten die beiden 750er Spitzenmodelle regelrecht
majestätisch. Nicht nur optisch hatte BMW damit voll ins Schwarze
getroffen, auch im Fahrbetrieb bei Regen oder über verschmutzte Straßen
profitierte der ansonsten von Wind und Wetter geplagte Fahrer von diesem
Baustil. Schuhwerk und Hosenbeine blieben weitgehend sauber.
Ab 1938 stellte im Großen und
Ganzen BMW den Verkauf der R12 an die zivile Motorradkundschaft ein.
Hauptabnehmer für das Kraftrad, wahlweise ohne oder mit Beiwagen, waren
nun die Wehrmacht sowie andere Behörden. Bis 1941 liefen rund 36.000 R12
Maschinen vom Band, eine Stückzahl, die zuvor noch kein anderes BMW
Motorrad erreicht hatte.
|
|
|
|
BMW R17 von 1936
(4 Fotos: BMW) |
|
Das 33 PS starke Schwestermodell R17 mit 750er ohv-Boxer-Motor durfte mit
Recht den Titel Sportmaschine für sich in Anspruch nehmen. Mit über 140
km/h Höchstgeschwindigkeit gehörte sie damals zu den schnellsten
Maschinen, die es auf dem Markt zu kaufen gab. Bis zum Produktionsende
1938 wurden gut 450 Exemplare gebaut.
|
|
Christian Krause, BMW Boxer-Fan
aus Leidenschaft
 |
|
Wenn es um altes Eisen, verrostetes Blech, vergilbtes Leder, undichte
Kessel oder marode Holzgestelle geht, ist Christian Krause in seinem
Element. Das "Technische Landesmuseum in Wismar" ist sein Arbeitsplatz.
Hier ist er als Techniker für die Restaurierung und den Erhalt technischer
Kulturgüter zuständig. Die Bandbreite reicht von Autos über LKWs,
Motorräder, Flugzeuge, Schiffsmotoren bis hin zu Dampfmaschinen.
"Diese Arbeit ist sehr abwechslungsreich, stellt einen immer wieder vor
neue handwerkliche Herausforderungen und macht dazu auch noch großen
Spaß", verrät Christian Krause, Jahrgang 1969. Wer sich den ganzen Tag um
historisches Material kümmern darf, hat sicherlich wenig Lust, sich nach
Feierabend oder gar am Wochenende auch noch damit zu beschäftigen. Macht
er auch nicht, mit einer Ausnahme: Seine Freizeitleidenschaft gehört den
BMW Vorkriegs-Modellen. Und davon hat er einige. Zum Beispiel eine R35 von
1935, eine R71 von 1936, eine R11von 1934 und ein Wehrmachtsgespann R12
von 1940. Das Gespann ist sein Lieblingsmotorrad und in diesem Bericht
gleichzeitig der Hauptdarsteller. Von der Geschichte weiß Christian
Krause: "Die R12 wurde am 19. September 1940 im Münchener BMW-Werk
produziert und schon am nächsten Tag mit einem Behördenbeiwagen in
Feldgrau an die rumänische Luftfahrt- und Marineeinheit in Bukarest
ausgeliefert. Nach dem Krieg kam die BMW zurück nach Deutschland und fand
im Schwarzwald einen neuen Besitzer. Von gut 10 Jahren habe ich die R12
ihm abgekauft."
|
|

|
|
Nun
stand in Krauses Schrauberwerkstatt ein 60 Jahre altes Wehrmachtsgespann.
Nicht fahrbereit, etliche Teile wie Schutzbleche, Auspuffanlage und Sattel
fehlten. Von dem einst ehrwürdigen Erscheinungsbild war keine Rede mehr.
Begonnen hatten die Zweiradambitionen bereits 1985 mit einer MZ TS150. Es
folgten AWO-Modelle, später eine 500er Yamaha und dann eine 1200er
Harley-Davidson Shovelhead von 1977. Pflege und Wartung wurden stets selbst erledigt.
|
|

|
|
Von
vornherein stand für mich fest, dass das R12 Gespann wie einst wieder auf
seinen drei Rädern stehen sollte. Zunächst habe ich mir Literatur besorgt,
habe die Fahrzeughistorie studiert und Adressen für Ersatzteilversorgung
gesammelt. Die erste Ausführung hatte breite Schutzbleche. Schnell stellte
sich damals allerdings heraus, dass sich im groben Gelände zwischen Reifen
und Schutzblech Erdreich festsetzte und das Rad am freien Drehen
behinderte. Schmalere Radabdeckungen brachten Abhilfe. Aber noch ein
weiterer Faktor war für die Änderung wichtig. Anders als heute, war man
damals das ganze Jahr über mit den Maschinen auf Achse. Eben auch im
Winter auf verschneiten Straßen und da wurden Schneeketten aufgezogen. Von
Werk aus war mein Gespann feldgrau, bei der neuen Lackierung entschied ich
mich jedoch für dunkelgrau", lässt der Boxer-Experte wissen.
|
|

|
 |
|

|
|
Rund drei Jahre vergingen, bis
nach seinen Vorstellungen das Wehrmachtsgespann fertig restauriert war.
Nach Anlaufschwierigkeiten schnurrt der Oldtimer inzwischen wie eine Eins.
Nichts verändert hat sich am Startprozess: Benzinhahn öffnen,
Schwimmerkammer fluten, zwei bis drei Mal den Kickstarter mit Schmackes herabtreten, Zündung einschalten, nach dem ersten, spätestens nach dem
zweiten Tritt auf den Kickstarter läuft der 750er sv-Motor. |
|

|
|
Ausfahrten
mit dem R12-Gespann sind für mich Zeitreisen in die Vergangenheit. In eine
Epoche, als morgens das Kalenderblatt um einen Tag umgeblättert wurde, als
die Zeit noch in Wochen und Monate geteilt waren. Verantwortlich für die
gemütliche Fahrweise ist die Motorcharakteristik. Mit Dampf aus dem
Drehzahlkeller schiebt das Triebwerk mit kaum spürbaren Vibrationen die
Fuhre vorwärts. Im Nu sind die Gänge durchgeschaltet. Im
Geschwindigkeitsbereich von 30 bis 80 km/h bleibt der vierten Gang bis zum
nächsten Stopp eingelegt", schwärmt Christian Krause von seinem inzwischen
70 Jahre alten Wehrmachtsgespann. |